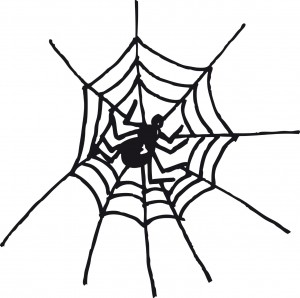Kategorie: ‘RWTH Aachen’
Acht
Vor was haben wir eigentlich heute noch Angst? Krankheit, Einsamkeit oder doch der guten alten Spinne? Beate Böker hat in unserem Seminar: Texte in Arbeit eine ergreifende Kurzgeschichte geschrieben. Irgendwo zwischen Fiktion und Zukunft. Los geht`s in Zehn, Neun:
Acht
Nur noch eine Viertelstunde bis Feierabend. Dann einkaufen, kochen und den Rest des Abends gemeinsam fernsehen. Wir sind froh, wenn wir hier raus kommen.
Im Büro ist alles wie üblich. Die Kollegen schauen unauffällig hinüber, doch sobald ich ihre gaffenden Blicke erwidert möchte, sehen sie weg und tun so, als seien sie beschäftigt. Doch ich weiß, dass sie mich anstarren. Ich spüre ihre Blicke wieder, sobald ich nicht mehr hinsehe. Sie lassen mich nicht aus den Augen. Wahrscheinlich raten ihnen ihre Instinkte, mich gleich an Ort und Stelle zu beseitigen, wie sie es üblicherweise tun würden, wenn sie mir in ihren Kellern oder Garagen begegnen.
Jasmins Finger tanzen unter mir über die Tastatur. Sie ignoriert die Blicke; wahrscheinlich bemerkt sie die Gaffer gar nicht mehr. Menschen sind immerhin Gewohnheitstiere, so viel habe ich schon herausgefunden. Ich hingegen bin mir nicht sicher, ob ich mich jemals daran gewöhnen werde. Ich bin schließlich eine Spinne.
Bei einem Verkehrsunfall wurde ein großer Teil von Jasmins Gehirn zerstört. Dank einer neuartigen Behandlungsmethode hat sie überlebt: Mein Körper sitzt in Jasmins Schädel und ersetzt die fehlenden Teile ihres Hirns. Die Folgen sind für uns beide akzeptabel. Wenn Jasmin schläft, sehe ich, was sie träumt. Eigenartigerweise kann ich ihre Gedanken nicht lesen, wenn sie wach ist – sie aber dafür meine. Das ist praktisch, weil sie dadurch direkt weiß, wenn ich hungrig bin.
Meine haarigen Beine hängen rechts und links an ihrem Kopf herunter. Über ihrer Stirn, dort wo einst der Haaransatz war, sitzen jetzt meine Beißer und direkt darüber meine acht Augen. Alles was Jasmin sieht, sehe ich also auch.
Jasmin fährt danach endlich den Rechner runter und packt ihre Sachen. Wir verlassen das Büro. Ich kann eine Welle der Erleichterung hinter uns spüren, ein Aufatmen, als seien die Kollegen froh, dass wir endlich weg sind.
Auf dem Korridor stehen einige Leute vor dem Aufzug. Als sie uns kommen sehen, entschließen sie sich plötzlich alle gleichzeitig dazu, die Treppe zu nehmen. Sie grüßen Jasmin zwar höflich im Vorbeigehen, doch ihre Körperhaltung und ihr gezwungenes Vermeiden von Blickkontakt erinnern an Flucht.
Während wir zu seichtem Aufzug-Swing nach unten fahren, mache ich mir Gedanken, wie Jasmin es wohl empfindet, von allen gemieden zu werden. Es hat lange gedauert, aber irgendwann habe ich begriffen, dass Menschen Rudeltiere sind und Gesellschaft mit ihresgleichen suchen.
Ruiniere ich ihr Leben, weil sie meinetwegen keinen Anschluss findet? Oder ruiniert sie meines, weil man mich, um sie zu retten, aus dem Dschungel Sumatras entführt und auf einen Menschenkopf in Deutschland verpflanzt hat? Ich könnte im Urwald das gewöhnliche Leben einer Spinne leben, aber auch mir bleibt die Möglichkeit ein normales Leben zu führen für immer versagt.
„Zerbrich dir nicht unseren Kopf!“, sagt Jasmin und schiebt mir einen Keks zwischen die Beißer, wie immer, wenn ich solchen Gedanken nachgehe.
Ich mag Kekse. Aber sie lösen das Problem nicht. Nicht auf Dauer.
Aus dem Seminar direkt in die Zeitung: Eine Reportage in der Uniklinik RWTH Aachen
Wir freuen uns sehr, dass erneut ein Text unseres Seminars Journalistisches Schreiben veröffentlicht worden ist. Marie Ludwigs Reportage über den Arbeitstag eines Onkologen an der Uniklinik RWTH Aachen erschien vergangene Woche in der Aachener Zeitung / Aachener Nachrichten (magazin). Wer die Ausgabe verpasst hat, kann den Text hier in voller Länge nachlesen:
Von Marie Ludwig
Allmorgendlich strömen zum Schichtwechsel Ärzte, Schwestern und Fachkräfte ins Aachener Uniklinikum. In der Masse: ein Mann mit Mountainbike. Zügig bahnt er sich den Weg durch die geschäftige Menge. Dr. Jens Panse Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt Hämatologie und Internistische Onkologie sowie Paliativmedizin und arbeitet seit viereinhalb Jahren im Uniklinikum. Wie sieht ein typischer Arbeitstag eines Onkologen aus? Wir haben ihn begleitet…
7.15 Uhr: Jens Panse erreicht nach dem allmorgendlichen Radfahrsport sein Büro: „So bleibe ich fit!“, bemerkt er, während er sich den Schweiß von der Stirn wischt.
Nach dem ersten Kaffee wirft er sich kurzerhand in den weißen Kittel, um den Weg zur Besprechung der Patientenfälle anzutreten. In einem Dauerlauftempo, das selbst den größten Morgenmuffel letztlich erwachen lassen würde, fegt Jens Panse mit flatterndem Kittel durch die labyrinthartigen Gänge des Klinikums.
Ein kleiner Hörsaal ist das Ziel. Alle Oberärzte, Assistenzärzte, praktizierende Studenten und natürlich Chefarzt Tim Brümmendorf besprechen anhand zahlreicher Computertomographien die Krankheitsbilder der Neuankömmlinge auf der Station.
7.55 Uhr: Nach der Großbesprechung führt Panses Weg zur Station. In einem kleinen Raum voller Spinde mit Schaumstoffblümchen und elf Krankenschwestern wirkt der 1,83 Meter große Jens Panse etwas fehl am Platz. Doch der fachliche Austausch verbindet. An einem großen Tisch wird kräftig diskutiert. Wer hier nicht das Fachvokabular beherrscht, wird wohl wenig verstehen.
Doch selbst für einen Laien wird eines schnell klar: Die Schwestern und Pfleger der Station haben einiges zu leisten. Neben der zu behandelnden Krebsart leiden manche Patienten auch unter psychischen Erkrankungen.
8.30 Uhr: Nach der Besprechung geht es im Stechschritt auf die ambulante Station der Onkologie. „Die Aufzüge benutzen hier meist nur die Patienten“, bemerkt Panse und zwinkert einem Kollegen zu, der mit einem Cityroller durch die grünen Teppichflure fährt. Auf der Ambulanz angekommen, bahnt sich Panse seinen Weg durch den Chemotherapie-Aufenthaltsraum, in dem zahlreiche, weich gepolsterte blaue Sessel stehen. Ein Patient erhält hier beispielsweise alle drei Wochen Therapie, manchmal wird die Chemo einmal pro Woche verabreicht .
10 Uhr: Nach der Visite auf der Ambulanz und im Labor führt der Weg des Oberarztes zu einer weiteren Besprechung. Denn neben der Visite sind auch die Vor- und Nachbereitungen der Chemo wichtig. Insgesamt ist auf der onkologischen Station für etwa 48 Personen Platz. Zwischen warmer Heizungsluft, Atemschutz und Desinfektionsmitteln kann einem schon mal schnell schummrig werden, doch die klinische Sauberkeit ist hier ein Muss. Andernfalls würden die stationären Patienten von der kleinsten bakteriellen Infektion schwer erkranken.
11.20 Uhr: In kleiner Runde – zwei Assistenzärzte, drei auszubildende Studierende und ein Pfleger – geht es nun zur Visite. Denn neben der ärztlichen Untersuchung unterrichtet der Oberarzt die Studenten im Umgang mit den Patienten und stellt ihnen knifflige Fragen zu den Krankheitsbildern.
Bei der Untersuchung jedoch wechselt Jens Panse vom Lehrer zum einfühlsamen Vertrauten. Herzlich begrüßt er seine Patienten, nimmt sich Zeit, beantwortet zahlreiche Fragen und legt auch einmal beruhigend den Arm auf die Schulter. Auf die Frage, warum er sich ausgerechnet die Onkologie ausgesucht habe, wirft er lachend den Kopf in den Nacken: „Die meisten Menschen erwarten auf einer Krebsstation eine düstere, morbide Atmosphäre. Doch damit ist man auf dieser Station gewiss am falschen Platz.“
Bei seiner Frau, die als Kinderärztin arbeite, seien alle, die das erfahren, immer glücklich: „Aber wenn die Leute hören, dass ich Onkologe bin, dann bemitleiden sie mich“, fährt Panse kopfschüttelnd fort. Er hingegen lerne seine Patienten wirklich kennen und sei froh, Onkologe geworden zu sein.
13 Uhr: Nach der Visite geht es zur gefühlt zehnten Besprechung des Tages. Hier sind alle Ärzte der Ambulanz und Station anwesend. Im Anschluss an die einstündige Sitzung führt der Weg im Rudel in die Cafeteria. Mit in der Runde ist auch Chefarzt Tim Brümmendorf. Seit 2009 arbeiten er und sein Stellvertreter Jens Panse am Uniklinikum. Ihre Mission unter anderem: Der Aufbau einer Station für Stammzellentransplantation. Die Entwicklung zu einem onkologischen Spitzenzentrum, dem Euregionalen Comprehensive Cancer Center Aachens (ECCA) schreitet voran.
Bei der Frage, warum er gerade Jens Panse aus seinem früheren Team der Hamburger Klinik mitgenommen habe, beginnt Brümmendorf zu strahlen: „Jens Panse ist aus meiner Sicht ein Vorzeigemitarbeiter. Er erweist große fachliche Kompetenz, er ist herzlich, er ist direkt – ein Seelenverwandter.“
15.30 Uhr: Als nächste Etappe des Tages wartet auf Jens Panse die interdisziplinäre Tumorkonferenz. Neben den Onkologen treffen hier Pathologen, Radiologen und die andere Fachärzte zusammen und diskutieren Patientenfälle. Mit zwei Beamern werden CT-Bilder, mikroskopische Aufnahmen von Stammzellen und die Patientendokumentation an die Wand geworfen. Beim letzten CT-Bild einer Patientin hält Panse plötzlich inne: „Wir sollten herausfinden, was das für Knödel im linken Lungenflügel sind“, bemerkt er und beißt in eine Möhre. Die Sitzung findet im großen Piepergeklingel ein Ende, und die Ärzte strömen in allen Richtungen aus dem Saal.
17 Uhr: Der Weg des Oberarztes führt aus dem Konferenzsaal in Richtung Forschungslabor, um die Analysen durchzugehen. Im Anschluss geht es im Galopp wieder auf die Station, um die Patienten ein weiteres Mal zu besuchen. Letztlich warten zahlreiche Mails darauf, beantwortet zu werden. Denn neben seiner Stellung als Oberarzt hat Jens Panse noch weitere Posten: Stellvertretender Klinikdirektor der Onkologie, Medizinischer Leiter des ECCA und des Labors für Immunphänotypisierung, die Organisation von Projekten wie „Nichtrauchen ist cool Euregio“ sowie die Veranstaltungsreihe „Leben mit Krebs“ für Erkrankte, Angehörige und Interessierte.
Doch neben diesen zahlreichen Ämtern ist Jens Panse auch Familienvater: „Natürlich trägt man einen Teil der Arbeit mit nach Hause.“ Er nimmt die schwarz umrahmte Brille ab und fährt sich über sein kurz rasiertes Haar: „Da gab es einen Fall in meinen Anfangsjahren: ein 32-jähriger Patient, Vater einer einjährigen Tochter, erstickt an einem Lungentumor.“ Panse nickt, ja, das sei sehr berührend gewesen, aber mit der Zeit lerne man, wie man Abstand zum Beruf bekommen kann: „Fahrradfahren und Musik an, dann bin ich direkt raus!“
20 Uhr: Die Sonne ist schon längst untergegangen, als es in der Klinik zum Wechsel zur Nachtschicht merklich ruhiger wird. Jens Panse windet sich aus seinem weißen Kittel und hängt ihn sorgfältig an einem Bügel auf.
Ernsthaft bekundet er, dass es in seinem Beruf nicht nur um Tod und Verderben gehe: „Es werden wirklich viele Menschen vom Krebs geheilt. Das darf man nicht vergessen!“ Das wirklich Schlimme an seinem Beruf sei, dass er sich manchmal eher wie ein Verwalter fühle und nicht mehr wie ein Arzt. „Ich wünsche mir, dass die Klinik den Weg zurück zum Patienten findet und ihn nicht zum Kunden macht.“ Er verlässt das futuristische Uniklinikum mit seinen silbernen Wänden und grünen Teppichböden und meint: „Ich glaube, das Wichtigste ist, mit Herzblut bei der Sache zu sein!“