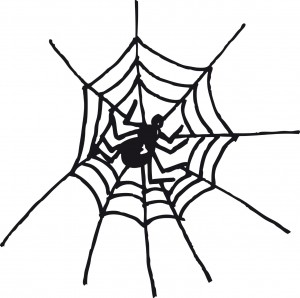Fragen an: Bernd Büttgens, Pressesprecher der Stadt Aachen
 Die erste Veranstaltung unserer hauseigenen Reihe „Fragen an…“ war ein voller Erfolg. Bernd Büttgens hat uns am 21. Mai in der BIB II erzählt, wie die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Aachen funktioniert. Es wurde aus dem Nähkästchen geplaudert, aber auch der Beruf im Bereich PR kritisch hinterfragt.
Die erste Veranstaltung unserer hauseigenen Reihe „Fragen an…“ war ein voller Erfolg. Bernd Büttgens hat uns am 21. Mai in der BIB II erzählt, wie die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Aachen funktioniert. Es wurde aus dem Nähkästchen geplaudert, aber auch der Beruf im Bereich PR kritisch hinterfragt.
Was haben wir mitgenommen?
1. Journalistische Kenntnisse sind für jeden guten PRler eine wichtige Sache!
2. Wer gerne mit Menschen arbeitet und einen vielseitigen Beruf haben möchte, ist im PR Bereich genau richtig.
3. Ein guter Pressesprecher schafft es Themen so interessant zu verkaufen, dass sie auch in die Zeitung kommen.
4. Das Wichtigste ist: immer bei der Wahrheit bleiben (…und zur Not einfach nicht alles erzählen 😉 ).
Im nächsten Semester haben wir wieder einen neuen Experten für euch eingeladen. Mehr dazu gibt`s bald.
Regenzeit – ZKS Story
Draußen regnet’s und ihr habt Lust auf Pizza? Da haben wir jetzt genau das Richtige für euch: eine Kurzgeschichte aus unserem Oberseminar: Texte in Arbeit.
Christine Hendriks versteht wie man unsere Gesellschaft durch eine scheinbar subtile Alltagssituation kritisieren kann. Taucht ein in die Zukunft mit quadratischer Paprikapizza und gefährlichem Regen und/oder gefährlichem Reden…
Regenzeit
Fira ist mit ihrer Mutter in der Innenstadt unterwegs. Es ist warm und regnet in Strömen wie jedes Jahr an Weihnachten. Graue Rinnsale umspülen ihre Gummistiefel.
Gut, dass ich dein Kleid eben noch imprägniert habe. Firas Mutter hat es eilig.
Mama, ich hab Hunger. Keine Antwort. Fira versucht mit den großen Schritten mitzuhalten. Eine Windböe weht ihr beinahe den Regenhut vom Kopf.
Seufz. Ihre Mutter bleibt stehen, drückt ihr den Hut fest auf den Kopf und macht den Gummizug einhändig fest. Der Regen ist ungesund.
Ich weiß. Mama, ich hab HUNGER!
Quälgeist.
Fira lacht zufrieden. Sie lassen sich zu einer kleinen Pizzeria führen. Es ist voll und der Boden bedeckt mit Pfützen. An der Theke sind noch drei Hocker frei. Fira betrachtet die Abbildungen und sucht sich eine Pizza mit Paprika aus. Die hatte ihre Oma früher immer gebacken, mit roten Paprika von ihrem Balkon. Leider war sie vor zwei Jahren bei einem Unwetter gestorben und den Balkon gab es auch nicht mehr. Fira bestätigt ihre Wahl. Vielen Dank für ihre Bestellung. Noch 15 Minuten bis zum Servieren.
Kind, du musst was trinken.
Fira nickt und schlürft die Cola durch einen dicken Strohhalm. Dabei zeigt sie ihrer Mutter die Ergebnisse vom letzten Test in Rechtschreibung.
Fast kein Fehler, sehr schön. Daumen hoch.
Fira freut sich.
Noch 10 Minuten bis zum Servieren. Sie schaut aus dem Fenster auf die Straße. Die Wassermassen sammeln sich in einer Rinne in der Mitte der Straße und fließen von da aus in den großen Kanalschacht. Menschen laufen mit gelben Plastikrucksäcken am Fenster vorbei. Es kribbelt in Firas Händen.
Schau mal. Ein alter Mann steht in der Tür der Pizzeria. Er trägt ein unförmiges Regencape und schüttelt einen Stock mit einer Halbkugel aus Stoff, sodass Regentropfen in alle Richtungen spritzen. Die Leute rümpfen die Nase und drehen sich weg. Er faltet das Ding zusammen und lässt seine glänzenden Augen über die Tische gleiten. Schließlich fällt sein Blick auf den letzten freien Hocker neben Fira. Er lächelt und setzt sich.
Mama, ich hab Angst.
Das ist nur ein Stummer. Und vor dem Schirm brauchst du keine Angst zu haben. Fira betrachtet ihn aus dem Augenwinkel, während er den Plastikumhang ablegt. Darunter kommen oben ein weißes Shirt mit hohem Kragen mit zwei spitzen Ecken und unten eine grobe blaue Hose zum Vorschein. Das sieht komisch aus.
Mama, er imprägniert nicht. Warum?
Er ist zurückgeblieben.
Noch 5 Minuten bis zum Servieren. Fira spürt das Grummeln in ihrem Bauch, aber der alte Mann hat ihre Neugier geweckt. Sie will ihn kontaktieren. − Er hat keine Nummer! Ihr Blick fällt auf seine leeren Hände und Fira zuckt zusammen. Er ist wirklich stumm. Der Mann schaut die Bedienung an und macht merkwürdige Gesten. Fira versteht nicht, was er meint, aber die Frau scheint ihn zu kennen. Sie stellt ihm mit der rechten Hand einen großen Bierkrug hin. Er nimmt ihn in beide Hände und hebt ihn direkt an den Mund. Igitt. Fira schüttelt sich. Kann er denn nicht das Trinkrohr benutzen? Sie schlürft an ihrer Cola.
Hier ist deine Pizza. Die Bedienung balanciert einen Teller vor sie hin. Darauf ist die viereckige Paprikapizza, in handliche Quadrate geschnitten. Fira entkoppelt ihre rechte Hand vom Sel-phone, nimmt sich ein Stück und beginnt zu essen.
„Guten Appetit, Kleine.“ Fira schielt zu dem alten Mann hoch, als sie die merkwürdigen Laute hört. Seine Augen schauen sie aus tiefen Höhlen an und er bewegt die Lippen.
Mama, ich mag keine Stummen.
Er tut dir nichts. Lass es dir schmecken.
Acht
Vor was haben wir eigentlich heute noch Angst? Krankheit, Einsamkeit oder doch der guten alten Spinne? Beate Böker hat in unserem Seminar: Texte in Arbeit eine ergreifende Kurzgeschichte geschrieben. Irgendwo zwischen Fiktion und Zukunft. Los geht`s in Zehn, Neun:
Acht
Nur noch eine Viertelstunde bis Feierabend. Dann einkaufen, kochen und den Rest des Abends gemeinsam fernsehen. Wir sind froh, wenn wir hier raus kommen.
Im Büro ist alles wie üblich. Die Kollegen schauen unauffällig hinüber, doch sobald ich ihre gaffenden Blicke erwidert möchte, sehen sie weg und tun so, als seien sie beschäftigt. Doch ich weiß, dass sie mich anstarren. Ich spüre ihre Blicke wieder, sobald ich nicht mehr hinsehe. Sie lassen mich nicht aus den Augen. Wahrscheinlich raten ihnen ihre Instinkte, mich gleich an Ort und Stelle zu beseitigen, wie sie es üblicherweise tun würden, wenn sie mir in ihren Kellern oder Garagen begegnen.
Jasmins Finger tanzen unter mir über die Tastatur. Sie ignoriert die Blicke; wahrscheinlich bemerkt sie die Gaffer gar nicht mehr. Menschen sind immerhin Gewohnheitstiere, so viel habe ich schon herausgefunden. Ich hingegen bin mir nicht sicher, ob ich mich jemals daran gewöhnen werde. Ich bin schließlich eine Spinne.
Bei einem Verkehrsunfall wurde ein großer Teil von Jasmins Gehirn zerstört. Dank einer neuartigen Behandlungsmethode hat sie überlebt: Mein Körper sitzt in Jasmins Schädel und ersetzt die fehlenden Teile ihres Hirns. Die Folgen sind für uns beide akzeptabel. Wenn Jasmin schläft, sehe ich, was sie träumt. Eigenartigerweise kann ich ihre Gedanken nicht lesen, wenn sie wach ist – sie aber dafür meine. Das ist praktisch, weil sie dadurch direkt weiß, wenn ich hungrig bin.
Meine haarigen Beine hängen rechts und links an ihrem Kopf herunter. Über ihrer Stirn, dort wo einst der Haaransatz war, sitzen jetzt meine Beißer und direkt darüber meine acht Augen. Alles was Jasmin sieht, sehe ich also auch.
Jasmin fährt danach endlich den Rechner runter und packt ihre Sachen. Wir verlassen das Büro. Ich kann eine Welle der Erleichterung hinter uns spüren, ein Aufatmen, als seien die Kollegen froh, dass wir endlich weg sind.
Auf dem Korridor stehen einige Leute vor dem Aufzug. Als sie uns kommen sehen, entschließen sie sich plötzlich alle gleichzeitig dazu, die Treppe zu nehmen. Sie grüßen Jasmin zwar höflich im Vorbeigehen, doch ihre Körperhaltung und ihr gezwungenes Vermeiden von Blickkontakt erinnern an Flucht.
Während wir zu seichtem Aufzug-Swing nach unten fahren, mache ich mir Gedanken, wie Jasmin es wohl empfindet, von allen gemieden zu werden. Es hat lange gedauert, aber irgendwann habe ich begriffen, dass Menschen Rudeltiere sind und Gesellschaft mit ihresgleichen suchen.
Ruiniere ich ihr Leben, weil sie meinetwegen keinen Anschluss findet? Oder ruiniert sie meines, weil man mich, um sie zu retten, aus dem Dschungel Sumatras entführt und auf einen Menschenkopf in Deutschland verpflanzt hat? Ich könnte im Urwald das gewöhnliche Leben einer Spinne leben, aber auch mir bleibt die Möglichkeit ein normales Leben zu führen für immer versagt.
„Zerbrich dir nicht unseren Kopf!“, sagt Jasmin und schiebt mir einen Keks zwischen die Beißer, wie immer, wenn ich solchen Gedanken nachgehe.
Ich mag Kekse. Aber sie lösen das Problem nicht. Nicht auf Dauer.
Solidarisches Saisongemüse
Als Student hat man meist keinen eigenen Garten, in dem man sich sein Gemüse anbauen kann: Aber es gibt auch Alternativen!!! Eine davon hat Beate Böker im Rahmen von unserem Kurs „Journalistisches Schreiben“ recherchiert und es sogar in die Märzausgabe vom Klenkes geschafft! Schaut doch mal rein…
ZKS Story – Das Wellengrab

Ein Haus am Meer, eine Frau, ein Mann – es könnte so schön sein. Doch ein Sturm tost über dem Meer.
Janina Gerlach aus unserem Oberseminar: Texte in Arbeit erzählt uns in ihrer Kurzgeschichte von Sarah und Tom.
Das Wellengrab
von Janina Gerlach
Noch vor einem Jahr verbrachten wir die Ferien in unserem Haus am Meer und schafften es, dem immer schneller laufenden Alltag für ein paar Tage zu entkommen. Laut prustend rollten wir uns auf dem Boden, und unser Gelächter erfüllte den ganzen Raum. Jeden sonnigen Tag verbrachten wir mit der Familie am Meer, tobten ausgelassen zwischen den Wellen und ließen uns anschließend in den warmen Sand fallen. Die Luft duftete nach frischaufgetragener Sonnencreme und geschmolzenem Erdbeereis.
Heute ist alles anders.
Tom und ich sitzen am Strand und schauen auf das graue Meer hinaus, wo die Wellen versuchen, sich an Höhe zu übertreffen. Donnernd kommen sie auf uns zugerollt und türmen sich auf, bis sie schließlich zerbersten und wieder in der blauen Masse untergehen. Dicke Regentropfen fallen von oben auf uns herab, doch wir rühren uns nicht. Ich schmiege mich enger an Tom und betrachte ihn von der Seite. Der Wind zerrt unaufhörlich an seinen kastanienfarbenen Haaren und weht ihm einige Strähnen ins Gesicht. Als er diese zurückstreicht und hinter sein Ohr klemmt, fällt mir auf, wie tief die Falten auf seiner Stirn geworden sind. Seit letztem Sommer ist nur ein Jahr vergangen, doch die ewige Angst hat ihre Spuren hinterlassen und lässt ihn älter wirken.
Vorsichtig lege ich meine Hand auf seine und spüre, wie kalt sie ist. Eine Möwe dreht über uns ihre Kreise, als Tom den Kopf dreht und mich ansieht. Für einen Moment verliere ich mich in den Tiefen seiner eisblauen Augen, dann verfolge ich die silbrig schimmernde Träne, die sich ihren Weg über seine Wange bahnt, dort einen kleinen Moment verweilt und schließlich in den Sand hinabstürzt. Dort versickert sie wie bereits so viele Tränen zuvor. Zu viele.
Als die dunklen Wolken am Himmel zu Bergen heranwachsen und der erste Blitz die Luft elektrisiert, wissen wir, dass es Zeit ist zu gehen. In stillem Einvernehmen stehen wir auf und stapfen Richtung Promenade. Zurück bleiben nur unsere Fußabdrücke im nassen Sand.
In der Nacht wälze ich mich im Bett umher, denn ich kann nicht schlafen. Ich drehe mich auf den Bauch und sehe durch das große Fenster nach draußen, wo der Wind dunkle Wolkenfetzen über den Himmel jagt; nur ab und zu blitzt der Mond durch die grauen Mauern. Für einen kleinen Moment erhellen seine Strahlen das Zimmer und ich kann erkennen, dass Tom ebenfalls wach liegt und mich anstarrt. „Sarah?“  Seine Bettdecke raschelt, als er sich auf die Seite dreht und flüstert: „Ich will nicht gehen.“
Seine Bettdecke raschelt, als er sich auf die Seite dreht und flüstert: „Ich will nicht gehen.“
„Ich weiß.“
Am nächsten Morgen ist er tot.
Dicke Tränen laufen über mein Gesicht, als ich das Haus verlasse und die Tür zuknalle. Ich habe gewusst, dass es eines Tage dazu kommen wird und doch will ich es nicht wahrhaben. Als ich den Strand erreiche, reiße ich mir die Schuhe von den Füßen und schleudere sie ins Meer. Ich bin für einen Moment ganz ruhig und schaue zum schwarzen Himmel empor, während der Wind mir Regentropfen ins Gesicht peitscht. Dann renne ich. Renne so schnell ich kann. Renne immer weiter. Renne, um zu vergessen.
Als ich endlich anhalte, steht mir das Wasser bis zum Hals. Es ist eiskalt und schnürt mir die Kehle zu. Ich nehme einen letzten hastigen Atemzug, dann geben meine Beine nach und ich gehe in die Knie. Sofort schließt sich die Wasserdecke über meinem Kopf und das wütende Meer zieht mich nach unten, wirft mich umher, bis ich das Gefühl für oben und unten verloren habe. Mein Körper ist kraftlos und schmerzt, doch die Wunden in meinem Inneren sind größer. Welchen Sinn soll das Leben ohne Tom noch haben?
Ich beschließe: keinen.
Als mein Atemreflex einsetzt, reiße ich den Mund auf und meine Lungen füllen sich mit Wasser. Wie ätzende Säure bahnt es sich den Weg in mein Inneres. Mein Herz rast, doch ich rühre mich nicht; lasse mich von der tosenden See davontragen, bis mir schwarz vor Augen wird und ich nichts mehr spüre.
ZKS Story – Tanz mit dem Tod
„Der Tanz ist schnell, zu schnell, aber selbst wenn man will, kann man nicht aufhören zu tanzen“. Katharina Schäfer aus dem Oberseminar: Texte in Arbeit erzählt in ihrer Kurzgeschichte vom Knochenmann. Kann es bei dem Tanz einen Sieger geben? Viel Spaß beim Schmökern!
Tanz mit dem Tod
von Katharina Schäfer
Er sitzt an einem alten, mit Farben übersäten Tisch. Schwach scheinen die letzten Sonnenstrahlen in den Raum. Bald schon wird es dunkel werden, doch das stört ihn nicht. In seiner Hand hält er einen abgenutzten alten Stift, der schon so oft benutzt worden ist, dass man ihn kaum als solchen erkennen kann. Vor ihm liegt eine große, noch unberührte Leinwand, die im Schein des Lichtes strahlend weiß erscheint. Unter einem Haufen Stifte, Pinsel, Farben und anderer Utensilien kann man den Umschlag eines Skizzenblockes erkennen.
Er hätte den Skizzenblock aufschlagen können. Doch macht es für ihn keinen Sinn, da alle Seiten denselben Inhalt haben. Schemenhafte Figuren, die in dunklen Farben gehalten sind.
Dunkle Schatten, meist ohne Gesicht, ohne Haare und ohne Geschlecht. Schaut man sich diese Figuren länger an, entdeckt man, dass die feinen Striche feste Konturen zeichnen, die unüblich für die weiche Haut der Menschen sind. Es sind Knochen, die hervorgehoben werden. Der schemenhafte Tod, der dem Betrachter auf jeder Seite entgegenspringt. Auf der ersten Seite in einer schwarzen Uniform oder vielleicht auch in einer grünen. Im Hintergrund kann man Unmengen an Waffen erkennen. Große Waffen, die auffällig und schwer das Bild füllen. Aber auch kleine Waffen, versteckt und nur bei genauer Betrachtung sichtbar. In der Mitte gibt es nur ein Bild, das anders ist als die anderen. Der Knochenmann, wieder in einem dunklen Anzug, diesmal jedoch mit etwas, das so aussieht wie eine Krawatte. Die Arme hat er ausgestreckt und hält eine zweite Figur darin, die weicher ist und lange, helle Haare hat. Weiblich sieht sie aus, diese Figur. Obwohl auch sie kein Gesicht besitzt. Der Betrachter könnte annehmen, es sei die Umarmung Liebender oder ein langsamer Tanz.
Der Künstler seufzt, während er nun doch das Skizzenbuch zur Hand nimmt. Es aus den Klauen von Farbe und Unordnung befreit. So viele Bilder. So viele Albträume. So vieles an Elend in der Welt und alles sammelt sich in seinem Kopf. Alles zeigt sich immer wieder in derselben undeutlichen und doch mächtigen Gestalt. Er träumt oft denselben Traum. Darin tanzt er in inniger Umarmung mit dem Knochenmann. Die Melodie ist süß, fast so süß wie der Kuss einer Frau. Der Tanz ist schnell, zu schnell, aber selbst wenn man will, kann man nicht aufhören zu tanzen. Der Tod lässt niemanden gehen, auch ihn nicht. Der Künstler weiß, was das Ende eines solchen Tanzes bedeutet.
Erneut füllt ein Seufzer den Raum. Schwerfällig erhebt sich der alte Mann und geht zum Fenster. Dort zündet er sich eine Pfeife an und nimmt einen gedankenverlorenen Zug. Mittlerweile ist es dunkel geworden. Von seinem großen, prächtigen Garten sind nur noch düstere Schatten zu sehen. Jetzt kann er mit dem Malen beginnen.
Er weiß, dass seine Frau bald nach ihm sehen und ihn bitten wird, mit ihr ins Bett zu kommen. Doch wird er an seinem Tisch sitzen bleiben, bis er das Gefühl hat, dass er nun malen kann. Er will nicht schlafen, solange ihn der Tod in seinen Träumen heimsucht. Nein, das ist es nicht wert. Mit einem plötzlichen Ruck wendet er sich vom Fenster ab, macht ein Licht an und setzt sich wieder. Es ist an der Zeit, den Tod im Tanz zu besiegen.
Die 2. Lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten
 Das Semesterende rückt immer näher – das heißt, die Haus- und Abschlussarbeiten wollen bald abgegeben werden. Aber: Die Gliederung steht noch nicht, die Literaturrecherche stockt und die richtigen Worte wollen so gar nicht kommen. Was also tun? Küche putzen? Mails checken? Abgabefrist verlängern? – Oder packt doch lieber mit Gleichgesinnten den Stier bei den Hörnern! Schnappt euch eure unfertige Hausarbeit und euren Laptop und kommt am 10. Februar zur Langen Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten.
Das Semesterende rückt immer näher – das heißt, die Haus- und Abschlussarbeiten wollen bald abgegeben werden. Aber: Die Gliederung steht noch nicht, die Literaturrecherche stockt und die richtigen Worte wollen so gar nicht kommen. Was also tun? Küche putzen? Mails checken? Abgabefrist verlängern? – Oder packt doch lieber mit Gleichgesinnten den Stier bei den Hörnern! Schnappt euch eure unfertige Hausarbeit und euren Laptop und kommt am 10. Februar zur Langen Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten.
Dort unterstützen wir euch dabei, Schreibprojekte in Angriff zu nehmen oder Angefangenes weiterzuführen: Nach einem gemeinsamen Warm-Up beginnt das Schreiben. Für individuelle Fragen stehen euch Ansprechpartner von Universitätsbibliothek, Sprachenzentrum und ZKS zur Verfügung. Außerdem könnt ihr euch in Mini-Workshops über wissenschaftliches Schreiben, English Writing und Textüberarbeitung informieren. Bei rauchenden Köpfen versorgt euch der AStA mit Kaffee, Tee und Wasser. Kekse und Obst geben neue Energie und beim Pausenexpress des Hochschulsportzentrums könnt ihr Muskeln und Gedanken lockern.
Und danach? Wieder zurück an den einsamen Schreibtisch? Keine Angst, auch nach der Langen Nacht helfen wir euch bei den angefangenen Schreibprojekten: Im Rahmen des RWTH-Lektorats bietet euch das ZKS in den folgenden drei Wochen individuelle Schreibberatung in der Universitätsbibliothek.
Eine Anmeldung zur Langen Nacht ist nicht nötig, kommt einfach um 19 Uhr vorbei und sichert euch euren Platz.
In diesem Sinne: Gute Nacht!
ZKS Story – Etwas Glänzendes
Eine Wette, ein Schatz, Ungeheuer – unsere neueste Kurzgeschichte hat alles was ein spannendes Abenteuer braucht. Lukas Cremer aus unserem Oberseminar: Texte in Arbeit erzählt euch packend von Olafs Mutprobe in einem Bergwerk. Nichts für schwache Nerven!
Etwas Glänzendes
von Lukas Cremer
Olaf umklammerte die Fackel fester und jagte durch die Stollen. Das hier war niemals so geplant gewesen. Und dafür war er nie ausgebildet worden. Er hatte doch immer nur einen ruhigen Job gewollt. Er verfluchte sich insgeheim dafür, immer den Mund zu voll zu nehmen. Und er verfluchte sich noch mehr dafür, gewagte Wetten einzugehen.
In ein stillgelegtes Bergwerk einzubrechen, war schon dumm. Aber Pieter hatte angeblich in einem tieferen Stollen etwas Glänzendes gefunden. Er hatte Olaf erzählt, dass nur ein Rascheln ihn davon abgehalten hätte, es sich zu greifen. Also hatte er mit Olaf nicht nur als bestem Kumpel, sondern hauptsächlich als leidenschaftlichem Kammerjäger darum gewettet, er würde es nicht schaffen, „das Viechzeugs plattzumachen!“. Olaf war selbstverständlich dabei. Wer konnte nicht ein paar Nuggets gebrauchen? Oder Diamanten, Rubine und Saphire? Nur hatte er feststellen müssen, dass es sich bei dem ‚Viechzeugs‘ erstens um Ratten handelte und diese zweitens nicht ‚plattgemacht‘ werden wollten. Stattdessen war jetzt ein Rudel von mindestens 60 Biestern dabei, ihn plattzumachen und jagte ihn durch die Gänge.
Die Orientierung hatte er längst verloren. Genauso seine gesamte Ausrüstung. Aber das war Olaf inzwischen egal. Sein bisschen Kammerjäger-Hokuspokus hätte vielleicht für zwei der Bestien gereicht. Er war auf Küchenschaben mit Vorort-Einfamilienhaus-Charme eingerichtet. Nicht auf diese Hölle. Dafür wäre mindestens ein Fegefeuer notwendig gewesen.
Bei der nächsten Gabelung rannte Olaf nach rechts. Es ging steil bergauf – das musste der Ausgang sein. Doch nach einer Kuppe schlitterte er überrascht einen Hang hinab, während die Meute hinter ihm ohrenbetäubend lärmte. Mehr stolpernd als laufend fand Olaf wieder festen Boden unter den Füßen.
Plötzlich war Stille. Als er sich umdrehte, waren die Ratten weg. Das Scharren, Trippeln und Fiepsen verlor sich so schnell, wie es eben noch hinter ihm hergewalzt war. Er lachte irre, er weinte, es war vorbei. Er hatte überlebt. Er wusste nicht warum, aber das war jetzt auch egal. Jetzt war alles egal. Es wurde Zeit, wieder ins Licht zu kommen.
Olaf ließ die Fackel sinken, um den Weg besser zu sehen. In dem Moment erkannte er seinen fatalen Fehler. Die Warnschilder. Die Ratten, die von ihm abgesehen hatten. Die Fackel. Es war so eindeutig. Gas. Er verfluchte sich einmal mehr. Bevor er dazu kam, in irres Lachen auszubrechen, konnte er nur noch an Pieter denken, an ihre Wette. Und an etwas Glänzendes.
ZKS Story – Fahr doch mal mit
Ferienzeit ist Reisezeit! Pünktlich dazu eine Kurzgeschichte aus der Feder von Marie Ludwig aus unserem Oberseminar: Texte in Arbeit. Wir wünschen euch schöne Feiertage und falls ihr auf Reisen geht, eine gute Fahrt!
Fahr doch mal mit
Eine Kurzgeschichte von Marie Ludwig
Bunte Lichter, laute Musik und eine unwahrscheinliche Hitze – auf den ersten Blick würde man denken, dass ich mich in einer Disco befände. Doch dem ist nicht so! Ich bin auf der A3. Genau genommen zwischen Oberhausen und Düsseldorf in einer proppenvollen Mitfahrgelegenheit: Zehn Menschen, die sich wohl nie auf „normalem“ Wege begegnet wären, noch eine verbliebene Stunde Fahrt und ich mittendrin. „Was war die verrückteste Geschichte, die du in deinem Leben jemals erlebt hast“, frage ich mich im Stillen, während ich ein Guckloch in das beschlagene Fenster wische: diese Fahrt ist sicherlich eine von solchen Geschichten, die man nur einmal erlebt.
Ich saß auf meinem Koffer an der U-Bahn-Station Friedrichsstraße in Berlin. Relativ zufrieden mit mir, dass ich das Mistding durch drei U-Bahnen, zwei Treppen ohne Rollfunktion und tausend drängelnde Menschenmassen katapultiert hatte. Alles lief nach Plan: Ich hatte die Kofferaktion überstanden, mir sogar noch ein fluffiges Croissant organisiert und ich hatte eine Mitfahrgelegenheit, die mich in 10 Minuten an ebendiesem Punkt abholen sollte. Gebannt beobachtete ich die Kennzeichen der Autos, die auf den Vorplatz der U-Bahnstation fuhren. Ich hatte gerade einen besonders großen Fetzen von meinem Croissant abgerissen, als ich ihn sah: Der weiße Transporter rollte auf mich zu und hielt mit der Stoßstange unmittelbar vor meiner Nase. Meine Augen, die voller Erstaunen bisher nur das Nummernschild wahrgenommen hatten, schweiften nach oben und starrten in das Gesicht des Fahrers Jerome. Dieser nickte mir zu, beugte sich aus dem Fenster und fragte: „Du Marie?“ Ich nickte, konnte mich aber nicht aus meiner Schockstarre herauswinden. Der circa 50-jährige Mann hinter dem Steuer des Wagens hätte einem Jerome nicht unähnlicher sein können. Dicke Pranken, auf einem mit grauem Plüsch besetzten Lenker. Dahinter ein voluminöser Körper, der mit seiner spärlichen Kopfbehaarung bis an die Autodecke reichte. Mit der linken Hand aus dem Fenster gestikulierend, gab mir Jerome zu verstehen, dass ich mich ins Auto bewegen sollte. Ich schluckte, schlang die Überreste des Croissants herunter und wuchtete meinen Koffer in Richtung Seitentüre.
Die Tür öffnete sich mit Wucht, und ich blickte in die Gesichter von sieben Menschen. Sieben Menschen, die sich scheinbar nicht besonders freuten mich zu sehen. „Ähm Jerome, du bist dir sicher, dass ich da noch reinpasse“, fragte ich kleinlaut durch den Schlitz zwischen Fenster und seinem speckigen Nacken. „Ich nix Jerome, Jerome krank! Ich Herr Virtis. Große Auto, viel Platz!“, bemerkte Herr
Virtis selbstzufrieden. Ich beschloss nichts mehr zu sagen und quetschte mich samt Koffer hinter Herr Virtis Sitz. In Embryonalstellung beobachtete ich meine Mitfahrer. Auf der Vorderbank: drei Typen, gleicher Klamottenstil, gleiche Frisuren. In meiner Bank: zwei Mädels, die unterschiedlicher nicht hätten sein können! Die Eine: blond, geschminkt, Minirock, künstliche Fingernägel. Die Andere: Piercings in Lippe und Braue, stämmig, kurze, gegelte Haare. In der letzten Reihe: eine schlafende Person und zwei unscheinbare Typen, die mit ihren Reiserucksäcken auf dem Schoß wenig glücklich dreinschauten. Doch schnell galt meine Aufmerksamkeit nur Einem: Herrn Virtis. Sich lauthals über den Verkehr beschwerend, manövrierte er den Transporter über die noch so kleinste Lücke durch den Berliner Straßenverkehr.
Trotz des wild auf- und abhüpfenden Herrn Virtis war die blonde Extensionschönheit Alina neben mir bereits bei der Autobahnauffahrt eingeschlafen. Während ich interessiert ihren mit Kleber benetzten Wimpernrand und ihr vom Makeup modelliertes Gesicht beobachtete, erfreuten sich die drei Jungs aus der ersten Reihe an Alinas offenstehenden Mund. Aus Verpackungsresten und Spucke bastelten die Sportstudenten kleine Kügelchen, die sie in Alinas Schlund zu versenken versuchten. Nach einer Verpackung Toffifee war es dann endlich soweit: Alina erwachte aus ihrem Schönheitsschlaf und spuckte zahlreiche Kügelchen in ihre Hände. Leicht verwirrt schüttelte sie ihre Haarpracht, wobei etliche Kügelchen auf uns herabschneiten. „Alta, jetzt bin isch voll dreckisch ey!“, keifte sie mehrfach im Auto herum und versuchte sich aus dem Toffifeebälleparadies zu befreien. Die Sportis auf der Vorderbank kugelten sich vor Freude und brachten mit ihren Witzen das ganze Auto in Hochstimmung. Naja, fast das ganze. Herr Virtis hatte nebenbei angefangen lauthals auf Türkisch über Headset zu telefonieren und nahm an dem Geschehen im Auto wenig teil. Inmitten dieses Zusammenspiels von türkischen Impulsivvorträgen, lachenden Fahrgästen und Alinas Hasstirade gegen Kügelchen in Ausschnitt, Haar und Hose, erwachte die schlafende Person auf dem Rücksitz. „Ey, Junge, ich muss mal sicken, jo!“, grummelte er mit benommener Stimme. Herr Virtis, der nicht sonderlich erfreut über die Unterbrechung seines Telefonats schien, drehte sich mit einem „Hä?“ zu uns um. Mit hektischen Handgriffen übernahm einer der Sportis kurzerhand das Steuer. „Du Pipi?“, fragte er mit hochgezogenen Brauen und wendete sich ächzend wieder nach vorn.
An der Raststätte angekommen, rannte der bisher unter der Jacke Verborgene eilends in Richtung der sanitären Anlagen. Als er zurückkehrte, konnte ich ihn zum ersten Mal wirklich wahrnehmen: ein spindeldürres Männlein, Baggyhose, Tanktop, rote Augen und das Kurioseste: drei kunterbunte Gameboys, die an seinem Gürtel befestigt, in seinen Schritt baumelten. Dass diese Elektrogeräte nicht nur für seine persönliche Bespaßung bestimmt waren, sollte ich noch schmerzvoll erfahren. In einigem Durcheinander und einer unglaublichen Redewelle des jüngst erwachten Gameboy-Jonas, stiegen wir zurück ins Auto. Noch zweieinhalb Stunden! Herr Virtis, der sich an der Raststätte mit einigen Snacks versorgt hatte, begann in einem unfassbaren Tempo Sonnenblumenkerne zu naschen. Wie ein Eichhörnchen trennte er Schalen vom Kern und spuckte Ungenießbares auf Armaturenbrett und Fußboden. Unglücklicherweise war jedoch das Fenster einen Spalt breit geöffnet. Vom Fahrtwind erfasst, ergoss sich ein Schalenregen über mich und die hintere Reihe. Ergriffen von diesem rauschenden Lautstärkepegel verkündet Gameboy-Jonas, dass er DJ sei und in Berlin bei einer „3-Tage-wach-Party“ aufgelegt habe. Alina, die der Toffiefeekampf stark gezeichnet hatte, drehte sich zu ihm um und verlangte nach einer Hörprobe. Ein Fehler!
Und da sitze ich nun. Irgendwo auf der A3. In einem weißen Transporter mit Entertainmentprogramm. Denn Jonas hat seine Gameboys nicht umsonst mit dabei. Zwischen Tetres- und Super-Mario-Sounds packt er zur visuellen Unterstützung einen Mini-Beamer aus, über welchen wir zahlreiche seiner Auftritte an der Autodecke miterleben dürfen. Nach einer Viertelstunde haben wir alle das Verlangen, dass Düsseldorf schnell in Sicht kommen möge! Nach einer halben Stunde versuchen wir Jonas klarzumachen, dass wir seine Musik schätzen, uns aber die bisherige Vorführung reichen würde. Nach einer Dreiviertelstunde steht die Stimmung im Auto an der Grenze zur Eskalation. Die Sportis und meine Reihe verlangen eindringlich, dass Jonas die Musik abdrehen soll. Die Rucksackfraktion neben ihm scheint bereits fertig mit der Welt zu sein. Von ihnen ist kein Lebenszeichen mehr zu vernehmen. Gameboy-Jonas scheint dies alles nicht zu stören; ekstatisch bewegt er sich zu den Rhythmen seiner Musik.
Als die rollende Gameboydisco nach einer Stunde Dauerbeschallung endlich auf den Düsseldorfer Parkplatz am HBF rollt, dröhnt es in meinem Kopf. Extension-Alina wirft sich schluchzend in die Arme eines muskelbepackten Sonnenstudiohelden, während ich mit einem Grinsen beobachte, wie der Rest der Besatzung fluchtartig in alle Richtungen davonströmt. Nur einer scheint nicht gehen zu wollen: Jonas packt mit sehnsüchtigem Blick seine Gameboys in den Rucksack, zieht seine Jacke an, bedankt sich für die tolle Fahrt und geht auf einen Mann in Anzug vor einer Mercedesklasse zu. Optisch scheint sein Vater die Leidenschaft für Gameboys wohl nicht zu teilen. Herr Virtis hingegen wartet ungeduldig darauf, dass seine zehn neuen Mitfahrer endlich Platz genommen haben. Diese blicken den vermeintlichen Jerome genauso ungläubig an wie ich am Morgen. Ich versichere ihnen mit einem Lachen, dass Herr Virtis ein ganz toller Fahrer sei und beobachte grinsend, wie der Transporter mit einem Affenzahn vom Parkplatz zurück in Richtung Berlin brettert.
Als ich am selben Abend unter der Dusche stehe und versonnen die Tetresmusik summe, fällt mein Blick auf das Abflussgitter: Ein Fetzen Toffifeepapier und einige Sonnenblumenkerne wirbeln im Wasser umher. Von dieser Fahrt habe ich doch wohl mehr mitgenommen, als ich dachte.
Aus dem Seminar direkt in die Zeitung: Eine Reportage in der Uniklinik RWTH Aachen
Wir freuen uns sehr, dass erneut ein Text unseres Seminars Journalistisches Schreiben veröffentlicht worden ist. Marie Ludwigs Reportage über den Arbeitstag eines Onkologen an der Uniklinik RWTH Aachen erschien vergangene Woche in der Aachener Zeitung / Aachener Nachrichten (magazin). Wer die Ausgabe verpasst hat, kann den Text hier in voller Länge nachlesen:
Von Marie Ludwig
Allmorgendlich strömen zum Schichtwechsel Ärzte, Schwestern und Fachkräfte ins Aachener Uniklinikum. In der Masse: ein Mann mit Mountainbike. Zügig bahnt er sich den Weg durch die geschäftige Menge. Dr. Jens Panse Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt Hämatologie und Internistische Onkologie sowie Paliativmedizin und arbeitet seit viereinhalb Jahren im Uniklinikum. Wie sieht ein typischer Arbeitstag eines Onkologen aus? Wir haben ihn begleitet…
7.15 Uhr: Jens Panse erreicht nach dem allmorgendlichen Radfahrsport sein Büro: „So bleibe ich fit!“, bemerkt er, während er sich den Schweiß von der Stirn wischt.
Nach dem ersten Kaffee wirft er sich kurzerhand in den weißen Kittel, um den Weg zur Besprechung der Patientenfälle anzutreten. In einem Dauerlauftempo, das selbst den größten Morgenmuffel letztlich erwachen lassen würde, fegt Jens Panse mit flatterndem Kittel durch die labyrinthartigen Gänge des Klinikums.
Ein kleiner Hörsaal ist das Ziel. Alle Oberärzte, Assistenzärzte, praktizierende Studenten und natürlich Chefarzt Tim Brümmendorf besprechen anhand zahlreicher Computertomographien die Krankheitsbilder der Neuankömmlinge auf der Station.
7.55 Uhr: Nach der Großbesprechung führt Panses Weg zur Station. In einem kleinen Raum voller Spinde mit Schaumstoffblümchen und elf Krankenschwestern wirkt der 1,83 Meter große Jens Panse etwas fehl am Platz. Doch der fachliche Austausch verbindet. An einem großen Tisch wird kräftig diskutiert. Wer hier nicht das Fachvokabular beherrscht, wird wohl wenig verstehen.
Doch selbst für einen Laien wird eines schnell klar: Die Schwestern und Pfleger der Station haben einiges zu leisten. Neben der zu behandelnden Krebsart leiden manche Patienten auch unter psychischen Erkrankungen.
8.30 Uhr: Nach der Besprechung geht es im Stechschritt auf die ambulante Station der Onkologie. „Die Aufzüge benutzen hier meist nur die Patienten“, bemerkt Panse und zwinkert einem Kollegen zu, der mit einem Cityroller durch die grünen Teppichflure fährt. Auf der Ambulanz angekommen, bahnt sich Panse seinen Weg durch den Chemotherapie-Aufenthaltsraum, in dem zahlreiche, weich gepolsterte blaue Sessel stehen. Ein Patient erhält hier beispielsweise alle drei Wochen Therapie, manchmal wird die Chemo einmal pro Woche verabreicht .
10 Uhr: Nach der Visite auf der Ambulanz und im Labor führt der Weg des Oberarztes zu einer weiteren Besprechung. Denn neben der Visite sind auch die Vor- und Nachbereitungen der Chemo wichtig. Insgesamt ist auf der onkologischen Station für etwa 48 Personen Platz. Zwischen warmer Heizungsluft, Atemschutz und Desinfektionsmitteln kann einem schon mal schnell schummrig werden, doch die klinische Sauberkeit ist hier ein Muss. Andernfalls würden die stationären Patienten von der kleinsten bakteriellen Infektion schwer erkranken.
11.20 Uhr: In kleiner Runde – zwei Assistenzärzte, drei auszubildende Studierende und ein Pfleger – geht es nun zur Visite. Denn neben der ärztlichen Untersuchung unterrichtet der Oberarzt die Studenten im Umgang mit den Patienten und stellt ihnen knifflige Fragen zu den Krankheitsbildern.
Bei der Untersuchung jedoch wechselt Jens Panse vom Lehrer zum einfühlsamen Vertrauten. Herzlich begrüßt er seine Patienten, nimmt sich Zeit, beantwortet zahlreiche Fragen und legt auch einmal beruhigend den Arm auf die Schulter. Auf die Frage, warum er sich ausgerechnet die Onkologie ausgesucht habe, wirft er lachend den Kopf in den Nacken: „Die meisten Menschen erwarten auf einer Krebsstation eine düstere, morbide Atmosphäre. Doch damit ist man auf dieser Station gewiss am falschen Platz.“
Bei seiner Frau, die als Kinderärztin arbeite, seien alle, die das erfahren, immer glücklich: „Aber wenn die Leute hören, dass ich Onkologe bin, dann bemitleiden sie mich“, fährt Panse kopfschüttelnd fort. Er hingegen lerne seine Patienten wirklich kennen und sei froh, Onkologe geworden zu sein.
13 Uhr: Nach der Visite geht es zur gefühlt zehnten Besprechung des Tages. Hier sind alle Ärzte der Ambulanz und Station anwesend. Im Anschluss an die einstündige Sitzung führt der Weg im Rudel in die Cafeteria. Mit in der Runde ist auch Chefarzt Tim Brümmendorf. Seit 2009 arbeiten er und sein Stellvertreter Jens Panse am Uniklinikum. Ihre Mission unter anderem: Der Aufbau einer Station für Stammzellentransplantation. Die Entwicklung zu einem onkologischen Spitzenzentrum, dem Euregionalen Comprehensive Cancer Center Aachens (ECCA) schreitet voran.
Bei der Frage, warum er gerade Jens Panse aus seinem früheren Team der Hamburger Klinik mitgenommen habe, beginnt Brümmendorf zu strahlen: „Jens Panse ist aus meiner Sicht ein Vorzeigemitarbeiter. Er erweist große fachliche Kompetenz, er ist herzlich, er ist direkt – ein Seelenverwandter.“
15.30 Uhr: Als nächste Etappe des Tages wartet auf Jens Panse die interdisziplinäre Tumorkonferenz. Neben den Onkologen treffen hier Pathologen, Radiologen und die andere Fachärzte zusammen und diskutieren Patientenfälle. Mit zwei Beamern werden CT-Bilder, mikroskopische Aufnahmen von Stammzellen und die Patientendokumentation an die Wand geworfen. Beim letzten CT-Bild einer Patientin hält Panse plötzlich inne: „Wir sollten herausfinden, was das für Knödel im linken Lungenflügel sind“, bemerkt er und beißt in eine Möhre. Die Sitzung findet im großen Piepergeklingel ein Ende, und die Ärzte strömen in allen Richtungen aus dem Saal.
17 Uhr: Der Weg des Oberarztes führt aus dem Konferenzsaal in Richtung Forschungslabor, um die Analysen durchzugehen. Im Anschluss geht es im Galopp wieder auf die Station, um die Patienten ein weiteres Mal zu besuchen. Letztlich warten zahlreiche Mails darauf, beantwortet zu werden. Denn neben seiner Stellung als Oberarzt hat Jens Panse noch weitere Posten: Stellvertretender Klinikdirektor der Onkologie, Medizinischer Leiter des ECCA und des Labors für Immunphänotypisierung, die Organisation von Projekten wie „Nichtrauchen ist cool Euregio“ sowie die Veranstaltungsreihe „Leben mit Krebs“ für Erkrankte, Angehörige und Interessierte.
Doch neben diesen zahlreichen Ämtern ist Jens Panse auch Familienvater: „Natürlich trägt man einen Teil der Arbeit mit nach Hause.“ Er nimmt die schwarz umrahmte Brille ab und fährt sich über sein kurz rasiertes Haar: „Da gab es einen Fall in meinen Anfangsjahren: ein 32-jähriger Patient, Vater einer einjährigen Tochter, erstickt an einem Lungentumor.“ Panse nickt, ja, das sei sehr berührend gewesen, aber mit der Zeit lerne man, wie man Abstand zum Beruf bekommen kann: „Fahrradfahren und Musik an, dann bin ich direkt raus!“
20 Uhr: Die Sonne ist schon längst untergegangen, als es in der Klinik zum Wechsel zur Nachtschicht merklich ruhiger wird. Jens Panse windet sich aus seinem weißen Kittel und hängt ihn sorgfältig an einem Bügel auf.
Ernsthaft bekundet er, dass es in seinem Beruf nicht nur um Tod und Verderben gehe: „Es werden wirklich viele Menschen vom Krebs geheilt. Das darf man nicht vergessen!“ Das wirklich Schlimme an seinem Beruf sei, dass er sich manchmal eher wie ein Verwalter fühle und nicht mehr wie ein Arzt. „Ich wünsche mir, dass die Klinik den Weg zurück zum Patienten findet und ihn nicht zum Kunden macht.“ Er verlässt das futuristische Uniklinikum mit seinen silbernen Wänden und grünen Teppichböden und meint: „Ich glaube, das Wichtigste ist, mit Herzblut bei der Sache zu sein!“