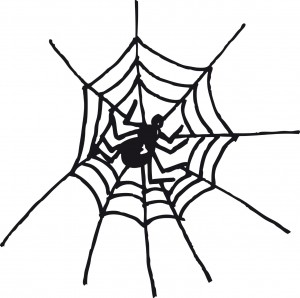Kategorie: ‘Allgemein’
Acht
Vor was haben wir eigentlich heute noch Angst? Krankheit, Einsamkeit oder doch der guten alten Spinne? Beate Böker hat in unserem Seminar: Texte in Arbeit eine ergreifende Kurzgeschichte geschrieben. Irgendwo zwischen Fiktion und Zukunft. Los geht`s in Zehn, Neun:
Acht
Nur noch eine Viertelstunde bis Feierabend. Dann einkaufen, kochen und den Rest des Abends gemeinsam fernsehen. Wir sind froh, wenn wir hier raus kommen.
Im Büro ist alles wie üblich. Die Kollegen schauen unauffällig hinüber, doch sobald ich ihre gaffenden Blicke erwidert möchte, sehen sie weg und tun so, als seien sie beschäftigt. Doch ich weiß, dass sie mich anstarren. Ich spüre ihre Blicke wieder, sobald ich nicht mehr hinsehe. Sie lassen mich nicht aus den Augen. Wahrscheinlich raten ihnen ihre Instinkte, mich gleich an Ort und Stelle zu beseitigen, wie sie es üblicherweise tun würden, wenn sie mir in ihren Kellern oder Garagen begegnen.
Jasmins Finger tanzen unter mir über die Tastatur. Sie ignoriert die Blicke; wahrscheinlich bemerkt sie die Gaffer gar nicht mehr. Menschen sind immerhin Gewohnheitstiere, so viel habe ich schon herausgefunden. Ich hingegen bin mir nicht sicher, ob ich mich jemals daran gewöhnen werde. Ich bin schließlich eine Spinne.
Bei einem Verkehrsunfall wurde ein großer Teil von Jasmins Gehirn zerstört. Dank einer neuartigen Behandlungsmethode hat sie überlebt: Mein Körper sitzt in Jasmins Schädel und ersetzt die fehlenden Teile ihres Hirns. Die Folgen sind für uns beide akzeptabel. Wenn Jasmin schläft, sehe ich, was sie träumt. Eigenartigerweise kann ich ihre Gedanken nicht lesen, wenn sie wach ist – sie aber dafür meine. Das ist praktisch, weil sie dadurch direkt weiß, wenn ich hungrig bin.
Meine haarigen Beine hängen rechts und links an ihrem Kopf herunter. Über ihrer Stirn, dort wo einst der Haaransatz war, sitzen jetzt meine Beißer und direkt darüber meine acht Augen. Alles was Jasmin sieht, sehe ich also auch.
Jasmin fährt danach endlich den Rechner runter und packt ihre Sachen. Wir verlassen das Büro. Ich kann eine Welle der Erleichterung hinter uns spüren, ein Aufatmen, als seien die Kollegen froh, dass wir endlich weg sind.
Auf dem Korridor stehen einige Leute vor dem Aufzug. Als sie uns kommen sehen, entschließen sie sich plötzlich alle gleichzeitig dazu, die Treppe zu nehmen. Sie grüßen Jasmin zwar höflich im Vorbeigehen, doch ihre Körperhaltung und ihr gezwungenes Vermeiden von Blickkontakt erinnern an Flucht.
Während wir zu seichtem Aufzug-Swing nach unten fahren, mache ich mir Gedanken, wie Jasmin es wohl empfindet, von allen gemieden zu werden. Es hat lange gedauert, aber irgendwann habe ich begriffen, dass Menschen Rudeltiere sind und Gesellschaft mit ihresgleichen suchen.
Ruiniere ich ihr Leben, weil sie meinetwegen keinen Anschluss findet? Oder ruiniert sie meines, weil man mich, um sie zu retten, aus dem Dschungel Sumatras entführt und auf einen Menschenkopf in Deutschland verpflanzt hat? Ich könnte im Urwald das gewöhnliche Leben einer Spinne leben, aber auch mir bleibt die Möglichkeit ein normales Leben zu führen für immer versagt.
„Zerbrich dir nicht unseren Kopf!“, sagt Jasmin und schiebt mir einen Keks zwischen die Beißer, wie immer, wenn ich solchen Gedanken nachgehe.
Ich mag Kekse. Aber sie lösen das Problem nicht. Nicht auf Dauer.
Solidarisches Saisongemüse
Als Student hat man meist keinen eigenen Garten, in dem man sich sein Gemüse anbauen kann: Aber es gibt auch Alternativen!!! Eine davon hat Beate Böker im Rahmen von unserem Kurs „Journalistisches Schreiben“ recherchiert und es sogar in die Märzausgabe vom Klenkes geschafft! Schaut doch mal rein…
ZKS Story – Das Wellengrab

Ein Haus am Meer, eine Frau, ein Mann – es könnte so schön sein. Doch ein Sturm tost über dem Meer.
Janina Gerlach aus unserem Oberseminar: Texte in Arbeit erzählt uns in ihrer Kurzgeschichte von Sarah und Tom.
Das Wellengrab
von Janina Gerlach
Noch vor einem Jahr verbrachten wir die Ferien in unserem Haus am Meer und schafften es, dem immer schneller laufenden Alltag für ein paar Tage zu entkommen. Laut prustend rollten wir uns auf dem Boden, und unser Gelächter erfüllte den ganzen Raum. Jeden sonnigen Tag verbrachten wir mit der Familie am Meer, tobten ausgelassen zwischen den Wellen und ließen uns anschließend in den warmen Sand fallen. Die Luft duftete nach frischaufgetragener Sonnencreme und geschmolzenem Erdbeereis.
Heute ist alles anders.
Tom und ich sitzen am Strand und schauen auf das graue Meer hinaus, wo die Wellen versuchen, sich an Höhe zu übertreffen. Donnernd kommen sie auf uns zugerollt und türmen sich auf, bis sie schließlich zerbersten und wieder in der blauen Masse untergehen. Dicke Regentropfen fallen von oben auf uns herab, doch wir rühren uns nicht. Ich schmiege mich enger an Tom und betrachte ihn von der Seite. Der Wind zerrt unaufhörlich an seinen kastanienfarbenen Haaren und weht ihm einige Strähnen ins Gesicht. Als er diese zurückstreicht und hinter sein Ohr klemmt, fällt mir auf, wie tief die Falten auf seiner Stirn geworden sind. Seit letztem Sommer ist nur ein Jahr vergangen, doch die ewige Angst hat ihre Spuren hinterlassen und lässt ihn älter wirken.
Vorsichtig lege ich meine Hand auf seine und spüre, wie kalt sie ist. Eine Möwe dreht über uns ihre Kreise, als Tom den Kopf dreht und mich ansieht. Für einen Moment verliere ich mich in den Tiefen seiner eisblauen Augen, dann verfolge ich die silbrig schimmernde Träne, die sich ihren Weg über seine Wange bahnt, dort einen kleinen Moment verweilt und schließlich in den Sand hinabstürzt. Dort versickert sie wie bereits so viele Tränen zuvor. Zu viele.
Als die dunklen Wolken am Himmel zu Bergen heranwachsen und der erste Blitz die Luft elektrisiert, wissen wir, dass es Zeit ist zu gehen. In stillem Einvernehmen stehen wir auf und stapfen Richtung Promenade. Zurück bleiben nur unsere Fußabdrücke im nassen Sand.
In der Nacht wälze ich mich im Bett umher, denn ich kann nicht schlafen. Ich drehe mich auf den Bauch und sehe durch das große Fenster nach draußen, wo der Wind dunkle Wolkenfetzen über den Himmel jagt; nur ab und zu blitzt der Mond durch die grauen Mauern. Für einen kleinen Moment erhellen seine Strahlen das Zimmer und ich kann erkennen, dass Tom ebenfalls wach liegt und mich anstarrt. „Sarah?“  Seine Bettdecke raschelt, als er sich auf die Seite dreht und flüstert: „Ich will nicht gehen.“
Seine Bettdecke raschelt, als er sich auf die Seite dreht und flüstert: „Ich will nicht gehen.“
„Ich weiß.“
Am nächsten Morgen ist er tot.
Dicke Tränen laufen über mein Gesicht, als ich das Haus verlasse und die Tür zuknalle. Ich habe gewusst, dass es eines Tage dazu kommen wird und doch will ich es nicht wahrhaben. Als ich den Strand erreiche, reiße ich mir die Schuhe von den Füßen und schleudere sie ins Meer. Ich bin für einen Moment ganz ruhig und schaue zum schwarzen Himmel empor, während der Wind mir Regentropfen ins Gesicht peitscht. Dann renne ich. Renne so schnell ich kann. Renne immer weiter. Renne, um zu vergessen.
Als ich endlich anhalte, steht mir das Wasser bis zum Hals. Es ist eiskalt und schnürt mir die Kehle zu. Ich nehme einen letzten hastigen Atemzug, dann geben meine Beine nach und ich gehe in die Knie. Sofort schließt sich die Wasserdecke über meinem Kopf und das wütende Meer zieht mich nach unten, wirft mich umher, bis ich das Gefühl für oben und unten verloren habe. Mein Körper ist kraftlos und schmerzt, doch die Wunden in meinem Inneren sind größer. Welchen Sinn soll das Leben ohne Tom noch haben?
Ich beschließe: keinen.
Als mein Atemreflex einsetzt, reiße ich den Mund auf und meine Lungen füllen sich mit Wasser. Wie ätzende Säure bahnt es sich den Weg in mein Inneres. Mein Herz rast, doch ich rühre mich nicht; lasse mich von der tosenden See davontragen, bis mir schwarz vor Augen wird und ich nichts mehr spüre.
ZKS Story – Tanz mit dem Tod
„Der Tanz ist schnell, zu schnell, aber selbst wenn man will, kann man nicht aufhören zu tanzen“. Katharina Schäfer aus dem Oberseminar: Texte in Arbeit erzählt in ihrer Kurzgeschichte vom Knochenmann. Kann es bei dem Tanz einen Sieger geben? Viel Spaß beim Schmökern!
Tanz mit dem Tod
von Katharina Schäfer
Er sitzt an einem alten, mit Farben übersäten Tisch. Schwach scheinen die letzten Sonnenstrahlen in den Raum. Bald schon wird es dunkel werden, doch das stört ihn nicht. In seiner Hand hält er einen abgenutzten alten Stift, der schon so oft benutzt worden ist, dass man ihn kaum als solchen erkennen kann. Vor ihm liegt eine große, noch unberührte Leinwand, die im Schein des Lichtes strahlend weiß erscheint. Unter einem Haufen Stifte, Pinsel, Farben und anderer Utensilien kann man den Umschlag eines Skizzenblockes erkennen.
Er hätte den Skizzenblock aufschlagen können. Doch macht es für ihn keinen Sinn, da alle Seiten denselben Inhalt haben. Schemenhafte Figuren, die in dunklen Farben gehalten sind.
Dunkle Schatten, meist ohne Gesicht, ohne Haare und ohne Geschlecht. Schaut man sich diese Figuren länger an, entdeckt man, dass die feinen Striche feste Konturen zeichnen, die unüblich für die weiche Haut der Menschen sind. Es sind Knochen, die hervorgehoben werden. Der schemenhafte Tod, der dem Betrachter auf jeder Seite entgegenspringt. Auf der ersten Seite in einer schwarzen Uniform oder vielleicht auch in einer grünen. Im Hintergrund kann man Unmengen an Waffen erkennen. Große Waffen, die auffällig und schwer das Bild füllen. Aber auch kleine Waffen, versteckt und nur bei genauer Betrachtung sichtbar. In der Mitte gibt es nur ein Bild, das anders ist als die anderen. Der Knochenmann, wieder in einem dunklen Anzug, diesmal jedoch mit etwas, das so aussieht wie eine Krawatte. Die Arme hat er ausgestreckt und hält eine zweite Figur darin, die weicher ist und lange, helle Haare hat. Weiblich sieht sie aus, diese Figur. Obwohl auch sie kein Gesicht besitzt. Der Betrachter könnte annehmen, es sei die Umarmung Liebender oder ein langsamer Tanz.
Der Künstler seufzt, während er nun doch das Skizzenbuch zur Hand nimmt. Es aus den Klauen von Farbe und Unordnung befreit. So viele Bilder. So viele Albträume. So vieles an Elend in der Welt und alles sammelt sich in seinem Kopf. Alles zeigt sich immer wieder in derselben undeutlichen und doch mächtigen Gestalt. Er träumt oft denselben Traum. Darin tanzt er in inniger Umarmung mit dem Knochenmann. Die Melodie ist süß, fast so süß wie der Kuss einer Frau. Der Tanz ist schnell, zu schnell, aber selbst wenn man will, kann man nicht aufhören zu tanzen. Der Tod lässt niemanden gehen, auch ihn nicht. Der Künstler weiß, was das Ende eines solchen Tanzes bedeutet.
Erneut füllt ein Seufzer den Raum. Schwerfällig erhebt sich der alte Mann und geht zum Fenster. Dort zündet er sich eine Pfeife an und nimmt einen gedankenverlorenen Zug. Mittlerweile ist es dunkel geworden. Von seinem großen, prächtigen Garten sind nur noch düstere Schatten zu sehen. Jetzt kann er mit dem Malen beginnen.
Er weiß, dass seine Frau bald nach ihm sehen und ihn bitten wird, mit ihr ins Bett zu kommen. Doch wird er an seinem Tisch sitzen bleiben, bis er das Gefühl hat, dass er nun malen kann. Er will nicht schlafen, solange ihn der Tod in seinen Träumen heimsucht. Nein, das ist es nicht wert. Mit einem plötzlichen Ruck wendet er sich vom Fenster ab, macht ein Licht an und setzt sich wieder. Es ist an der Zeit, den Tod im Tanz zu besiegen.
Die 2. Lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten
 Das Semesterende rückt immer näher – das heißt, die Haus- und Abschlussarbeiten wollen bald abgegeben werden. Aber: Die Gliederung steht noch nicht, die Literaturrecherche stockt und die richtigen Worte wollen so gar nicht kommen. Was also tun? Küche putzen? Mails checken? Abgabefrist verlängern? – Oder packt doch lieber mit Gleichgesinnten den Stier bei den Hörnern! Schnappt euch eure unfertige Hausarbeit und euren Laptop und kommt am 10. Februar zur Langen Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten.
Das Semesterende rückt immer näher – das heißt, die Haus- und Abschlussarbeiten wollen bald abgegeben werden. Aber: Die Gliederung steht noch nicht, die Literaturrecherche stockt und die richtigen Worte wollen so gar nicht kommen. Was also tun? Küche putzen? Mails checken? Abgabefrist verlängern? – Oder packt doch lieber mit Gleichgesinnten den Stier bei den Hörnern! Schnappt euch eure unfertige Hausarbeit und euren Laptop und kommt am 10. Februar zur Langen Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten.
Dort unterstützen wir euch dabei, Schreibprojekte in Angriff zu nehmen oder Angefangenes weiterzuführen: Nach einem gemeinsamen Warm-Up beginnt das Schreiben. Für individuelle Fragen stehen euch Ansprechpartner von Universitätsbibliothek, Sprachenzentrum und ZKS zur Verfügung. Außerdem könnt ihr euch in Mini-Workshops über wissenschaftliches Schreiben, English Writing und Textüberarbeitung informieren. Bei rauchenden Köpfen versorgt euch der AStA mit Kaffee, Tee und Wasser. Kekse und Obst geben neue Energie und beim Pausenexpress des Hochschulsportzentrums könnt ihr Muskeln und Gedanken lockern.
Und danach? Wieder zurück an den einsamen Schreibtisch? Keine Angst, auch nach der Langen Nacht helfen wir euch bei den angefangenen Schreibprojekten: Im Rahmen des RWTH-Lektorats bietet euch das ZKS in den folgenden drei Wochen individuelle Schreibberatung in der Universitätsbibliothek.
Eine Anmeldung zur Langen Nacht ist nicht nötig, kommt einfach um 19 Uhr vorbei und sichert euch euren Platz.
In diesem Sinne: Gute Nacht!
ZKS Story – Etwas Glänzendes
Eine Wette, ein Schatz, Ungeheuer – unsere neueste Kurzgeschichte hat alles was ein spannendes Abenteuer braucht. Lukas Cremer aus unserem Oberseminar: Texte in Arbeit erzählt euch packend von Olafs Mutprobe in einem Bergwerk. Nichts für schwache Nerven!
Etwas Glänzendes
von Lukas Cremer
Olaf umklammerte die Fackel fester und jagte durch die Stollen. Das hier war niemals so geplant gewesen. Und dafür war er nie ausgebildet worden. Er hatte doch immer nur einen ruhigen Job gewollt. Er verfluchte sich insgeheim dafür, immer den Mund zu voll zu nehmen. Und er verfluchte sich noch mehr dafür, gewagte Wetten einzugehen.
In ein stillgelegtes Bergwerk einzubrechen, war schon dumm. Aber Pieter hatte angeblich in einem tieferen Stollen etwas Glänzendes gefunden. Er hatte Olaf erzählt, dass nur ein Rascheln ihn davon abgehalten hätte, es sich zu greifen. Also hatte er mit Olaf nicht nur als bestem Kumpel, sondern hauptsächlich als leidenschaftlichem Kammerjäger darum gewettet, er würde es nicht schaffen, „das Viechzeugs plattzumachen!“. Olaf war selbstverständlich dabei. Wer konnte nicht ein paar Nuggets gebrauchen? Oder Diamanten, Rubine und Saphire? Nur hatte er feststellen müssen, dass es sich bei dem ‚Viechzeugs‘ erstens um Ratten handelte und diese zweitens nicht ‚plattgemacht‘ werden wollten. Stattdessen war jetzt ein Rudel von mindestens 60 Biestern dabei, ihn plattzumachen und jagte ihn durch die Gänge.
Die Orientierung hatte er längst verloren. Genauso seine gesamte Ausrüstung. Aber das war Olaf inzwischen egal. Sein bisschen Kammerjäger-Hokuspokus hätte vielleicht für zwei der Bestien gereicht. Er war auf Küchenschaben mit Vorort-Einfamilienhaus-Charme eingerichtet. Nicht auf diese Hölle. Dafür wäre mindestens ein Fegefeuer notwendig gewesen.
Bei der nächsten Gabelung rannte Olaf nach rechts. Es ging steil bergauf – das musste der Ausgang sein. Doch nach einer Kuppe schlitterte er überrascht einen Hang hinab, während die Meute hinter ihm ohrenbetäubend lärmte. Mehr stolpernd als laufend fand Olaf wieder festen Boden unter den Füßen.
Plötzlich war Stille. Als er sich umdrehte, waren die Ratten weg. Das Scharren, Trippeln und Fiepsen verlor sich so schnell, wie es eben noch hinter ihm hergewalzt war. Er lachte irre, er weinte, es war vorbei. Er hatte überlebt. Er wusste nicht warum, aber das war jetzt auch egal. Jetzt war alles egal. Es wurde Zeit, wieder ins Licht zu kommen.
Olaf ließ die Fackel sinken, um den Weg besser zu sehen. In dem Moment erkannte er seinen fatalen Fehler. Die Warnschilder. Die Ratten, die von ihm abgesehen hatten. Die Fackel. Es war so eindeutig. Gas. Er verfluchte sich einmal mehr. Bevor er dazu kam, in irres Lachen auszubrechen, konnte er nur noch an Pieter denken, an ihre Wette. Und an etwas Glänzendes.
ZKS Story – Fahr doch mal mit
Ferienzeit ist Reisezeit! Pünktlich dazu eine Kurzgeschichte aus der Feder von Marie Ludwig aus unserem Oberseminar: Texte in Arbeit. Wir wünschen euch schöne Feiertage und falls ihr auf Reisen geht, eine gute Fahrt!
Fahr doch mal mit
Eine Kurzgeschichte von Marie Ludwig
Bunte Lichter, laute Musik und eine unwahrscheinliche Hitze – auf den ersten Blick würde man denken, dass ich mich in einer Disco befände. Doch dem ist nicht so! Ich bin auf der A3. Genau genommen zwischen Oberhausen und Düsseldorf in einer proppenvollen Mitfahrgelegenheit: Zehn Menschen, die sich wohl nie auf „normalem“ Wege begegnet wären, noch eine verbliebene Stunde Fahrt und ich mittendrin. „Was war die verrückteste Geschichte, die du in deinem Leben jemals erlebt hast“, frage ich mich im Stillen, während ich ein Guckloch in das beschlagene Fenster wische: diese Fahrt ist sicherlich eine von solchen Geschichten, die man nur einmal erlebt.
Ich saß auf meinem Koffer an der U-Bahn-Station Friedrichsstraße in Berlin. Relativ zufrieden mit mir, dass ich das Mistding durch drei U-Bahnen, zwei Treppen ohne Rollfunktion und tausend drängelnde Menschenmassen katapultiert hatte. Alles lief nach Plan: Ich hatte die Kofferaktion überstanden, mir sogar noch ein fluffiges Croissant organisiert und ich hatte eine Mitfahrgelegenheit, die mich in 10 Minuten an ebendiesem Punkt abholen sollte. Gebannt beobachtete ich die Kennzeichen der Autos, die auf den Vorplatz der U-Bahnstation fuhren. Ich hatte gerade einen besonders großen Fetzen von meinem Croissant abgerissen, als ich ihn sah: Der weiße Transporter rollte auf mich zu und hielt mit der Stoßstange unmittelbar vor meiner Nase. Meine Augen, die voller Erstaunen bisher nur das Nummernschild wahrgenommen hatten, schweiften nach oben und starrten in das Gesicht des Fahrers Jerome. Dieser nickte mir zu, beugte sich aus dem Fenster und fragte: „Du Marie?“ Ich nickte, konnte mich aber nicht aus meiner Schockstarre herauswinden. Der circa 50-jährige Mann hinter dem Steuer des Wagens hätte einem Jerome nicht unähnlicher sein können. Dicke Pranken, auf einem mit grauem Plüsch besetzten Lenker. Dahinter ein voluminöser Körper, der mit seiner spärlichen Kopfbehaarung bis an die Autodecke reichte. Mit der linken Hand aus dem Fenster gestikulierend, gab mir Jerome zu verstehen, dass ich mich ins Auto bewegen sollte. Ich schluckte, schlang die Überreste des Croissants herunter und wuchtete meinen Koffer in Richtung Seitentüre.
Die Tür öffnete sich mit Wucht, und ich blickte in die Gesichter von sieben Menschen. Sieben Menschen, die sich scheinbar nicht besonders freuten mich zu sehen. „Ähm Jerome, du bist dir sicher, dass ich da noch reinpasse“, fragte ich kleinlaut durch den Schlitz zwischen Fenster und seinem speckigen Nacken. „Ich nix Jerome, Jerome krank! Ich Herr Virtis. Große Auto, viel Platz!“, bemerkte Herr
Virtis selbstzufrieden. Ich beschloss nichts mehr zu sagen und quetschte mich samt Koffer hinter Herr Virtis Sitz. In Embryonalstellung beobachtete ich meine Mitfahrer. Auf der Vorderbank: drei Typen, gleicher Klamottenstil, gleiche Frisuren. In meiner Bank: zwei Mädels, die unterschiedlicher nicht hätten sein können! Die Eine: blond, geschminkt, Minirock, künstliche Fingernägel. Die Andere: Piercings in Lippe und Braue, stämmig, kurze, gegelte Haare. In der letzten Reihe: eine schlafende Person und zwei unscheinbare Typen, die mit ihren Reiserucksäcken auf dem Schoß wenig glücklich dreinschauten. Doch schnell galt meine Aufmerksamkeit nur Einem: Herrn Virtis. Sich lauthals über den Verkehr beschwerend, manövrierte er den Transporter über die noch so kleinste Lücke durch den Berliner Straßenverkehr.
Trotz des wild auf- und abhüpfenden Herrn Virtis war die blonde Extensionschönheit Alina neben mir bereits bei der Autobahnauffahrt eingeschlafen. Während ich interessiert ihren mit Kleber benetzten Wimpernrand und ihr vom Makeup modelliertes Gesicht beobachtete, erfreuten sich die drei Jungs aus der ersten Reihe an Alinas offenstehenden Mund. Aus Verpackungsresten und Spucke bastelten die Sportstudenten kleine Kügelchen, die sie in Alinas Schlund zu versenken versuchten. Nach einer Verpackung Toffifee war es dann endlich soweit: Alina erwachte aus ihrem Schönheitsschlaf und spuckte zahlreiche Kügelchen in ihre Hände. Leicht verwirrt schüttelte sie ihre Haarpracht, wobei etliche Kügelchen auf uns herabschneiten. „Alta, jetzt bin isch voll dreckisch ey!“, keifte sie mehrfach im Auto herum und versuchte sich aus dem Toffifeebälleparadies zu befreien. Die Sportis auf der Vorderbank kugelten sich vor Freude und brachten mit ihren Witzen das ganze Auto in Hochstimmung. Naja, fast das ganze. Herr Virtis hatte nebenbei angefangen lauthals auf Türkisch über Headset zu telefonieren und nahm an dem Geschehen im Auto wenig teil. Inmitten dieses Zusammenspiels von türkischen Impulsivvorträgen, lachenden Fahrgästen und Alinas Hasstirade gegen Kügelchen in Ausschnitt, Haar und Hose, erwachte die schlafende Person auf dem Rücksitz. „Ey, Junge, ich muss mal sicken, jo!“, grummelte er mit benommener Stimme. Herr Virtis, der nicht sonderlich erfreut über die Unterbrechung seines Telefonats schien, drehte sich mit einem „Hä?“ zu uns um. Mit hektischen Handgriffen übernahm einer der Sportis kurzerhand das Steuer. „Du Pipi?“, fragte er mit hochgezogenen Brauen und wendete sich ächzend wieder nach vorn.
An der Raststätte angekommen, rannte der bisher unter der Jacke Verborgene eilends in Richtung der sanitären Anlagen. Als er zurückkehrte, konnte ich ihn zum ersten Mal wirklich wahrnehmen: ein spindeldürres Männlein, Baggyhose, Tanktop, rote Augen und das Kurioseste: drei kunterbunte Gameboys, die an seinem Gürtel befestigt, in seinen Schritt baumelten. Dass diese Elektrogeräte nicht nur für seine persönliche Bespaßung bestimmt waren, sollte ich noch schmerzvoll erfahren. In einigem Durcheinander und einer unglaublichen Redewelle des jüngst erwachten Gameboy-Jonas, stiegen wir zurück ins Auto. Noch zweieinhalb Stunden! Herr Virtis, der sich an der Raststätte mit einigen Snacks versorgt hatte, begann in einem unfassbaren Tempo Sonnenblumenkerne zu naschen. Wie ein Eichhörnchen trennte er Schalen vom Kern und spuckte Ungenießbares auf Armaturenbrett und Fußboden. Unglücklicherweise war jedoch das Fenster einen Spalt breit geöffnet. Vom Fahrtwind erfasst, ergoss sich ein Schalenregen über mich und die hintere Reihe. Ergriffen von diesem rauschenden Lautstärkepegel verkündet Gameboy-Jonas, dass er DJ sei und in Berlin bei einer „3-Tage-wach-Party“ aufgelegt habe. Alina, die der Toffiefeekampf stark gezeichnet hatte, drehte sich zu ihm um und verlangte nach einer Hörprobe. Ein Fehler!
Und da sitze ich nun. Irgendwo auf der A3. In einem weißen Transporter mit Entertainmentprogramm. Denn Jonas hat seine Gameboys nicht umsonst mit dabei. Zwischen Tetres- und Super-Mario-Sounds packt er zur visuellen Unterstützung einen Mini-Beamer aus, über welchen wir zahlreiche seiner Auftritte an der Autodecke miterleben dürfen. Nach einer Viertelstunde haben wir alle das Verlangen, dass Düsseldorf schnell in Sicht kommen möge! Nach einer halben Stunde versuchen wir Jonas klarzumachen, dass wir seine Musik schätzen, uns aber die bisherige Vorführung reichen würde. Nach einer Dreiviertelstunde steht die Stimmung im Auto an der Grenze zur Eskalation. Die Sportis und meine Reihe verlangen eindringlich, dass Jonas die Musik abdrehen soll. Die Rucksackfraktion neben ihm scheint bereits fertig mit der Welt zu sein. Von ihnen ist kein Lebenszeichen mehr zu vernehmen. Gameboy-Jonas scheint dies alles nicht zu stören; ekstatisch bewegt er sich zu den Rhythmen seiner Musik.
Als die rollende Gameboydisco nach einer Stunde Dauerbeschallung endlich auf den Düsseldorfer Parkplatz am HBF rollt, dröhnt es in meinem Kopf. Extension-Alina wirft sich schluchzend in die Arme eines muskelbepackten Sonnenstudiohelden, während ich mit einem Grinsen beobachte, wie der Rest der Besatzung fluchtartig in alle Richtungen davonströmt. Nur einer scheint nicht gehen zu wollen: Jonas packt mit sehnsüchtigem Blick seine Gameboys in den Rucksack, zieht seine Jacke an, bedankt sich für die tolle Fahrt und geht auf einen Mann in Anzug vor einer Mercedesklasse zu. Optisch scheint sein Vater die Leidenschaft für Gameboys wohl nicht zu teilen. Herr Virtis hingegen wartet ungeduldig darauf, dass seine zehn neuen Mitfahrer endlich Platz genommen haben. Diese blicken den vermeintlichen Jerome genauso ungläubig an wie ich am Morgen. Ich versichere ihnen mit einem Lachen, dass Herr Virtis ein ganz toller Fahrer sei und beobachte grinsend, wie der Transporter mit einem Affenzahn vom Parkplatz zurück in Richtung Berlin brettert.
Als ich am selben Abend unter der Dusche stehe und versonnen die Tetresmusik summe, fällt mein Blick auf das Abflussgitter: Ein Fetzen Toffifeepapier und einige Sonnenblumenkerne wirbeln im Wasser umher. Von dieser Fahrt habe ich doch wohl mehr mitgenommen, als ich dachte.
ZKS Story – Goldener Fisch
Ein frisch verheiratetes Paar, aber unglücklich? Und ein Fischer, der im venezianischen Abwasser nach Fischen sucht? Wie das zusammenpasst, erzählt Lars Heukens in seiner packenden und ironischen Kurzgeschichte „Goldener Fisch“, die in unserem Kurs: Kreatives Schreiben entstanden ist. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!
Goldener Fisch
von Lars Heuken
Roberto schnippte seine Zigarette in den Kanal. Sie landete mit leisem Zischen auf der braunen Brühe, sog sich langsam mit Wasser voll und verschwand unter der Oberfläche. Früher hatte er auf der Stufe neben der steinernen Brücke im Osten Venedigs immer Erfolg gehabt. Ja früher hatte Roberto eimerweise Fische gefangen.
Heute lag der einzige Fang des Tages in einer weißen Plastiktüte neben ihm auf dem Boden. Ein kleiner silbernen Fisch war eine magere Ausbeute für einen ganzen Tag angeln, rauchen und schnippen.
„Ich habe ein Zimmer reserviert, Fusco mein Name.“ „Willkommen im Hotel Venezia Senior Fusco, ach ja die Hochzeitssuite, sehr gerne“, antwortete der hagere Mann hinter der Rezeption auf die Frage des stilvoll gekleideten Mannes, welcher betont lässig an der Empfangstheke lehnte. „Dritte Etage links, einen schönen Aufenthalt und angenehme Flitterwochen wünsche ich Ihnen.“ „Danke“, grummelte der Gast und zog seine frisch angeheiratete Frau hinter sich her in Richtung des luxuriösen Aufzugs.
Mit leisem Surren holte Roberto die Schnur seiner Angel immer wieder ein. Auswerfen und einholen, einen ganzen Tag lang. Seine dreckigen klobigen Füße baumelten knapp über der Wasseroberfläche wie die Wurzeln eines alten knorrigen Baumes. Der modrige Duft des Salzwassers vermengt mit dem Gestank des Mülls und des Taubendrecks der Stadt stieg ihm in die Nase. Die herunterbrennende Abendsonne hatte seinen Armen eine Farbe wie die der beige-braunen Bogenbrücke neben ihm verliehen. Er stopfte sich lustlos eine neue Zigarette in den Mundwinkel und zündete sie an. Das Streichholz schnippte er in Richtung einer schwimmenden Ente, die er knapp verfehlte.
„Guck mal Darling, wie gut mein Ring zum Aufzug passt“, sagte die frisch Verheiratete zu Herrn Fusco. Dabei wedelte sie mit ihrer Hand vor seinem Gesicht. „Wenigstens ist er aus echtem Gold, 18 Karat“ murmelte er, während er versuchte den weißen Knopf mit der Aufschrift „Drei“ möglichst leger zu drücken. Die Tür schloss sich und der Aufzug setze sich in Bewegung. Ihr weißes Sommerkleid war am Morgen mit viel Sorgfalt ausgewählt worden und passte perfekt zu ihren Schuhen, welche mit einer kleinen Schleife verziert waren. Auf ihrem Zimmer ordnete sie ihre Haare und formte sie auf kunstvolle Weise zu einem Turm, während er den Fernseher testete und ihn voreingenommen als „Schrott“ bezeichnete. „Bin ich so fein genug für eine Erkundung der Stadt?“, fragte sie, während sie aus einer Flasche üppig Parfum auf sich und um sich verteilte. „Muss ich ja wohl, habe ja mit ‚Ja ich will‘ geantwortet“ sagte er und blickte teilnahmslos aus dem Fenster.
Boote waren die Feinde eines jeden Anglers in Venedig. Meist fuhren sie zu schnell und verursachten noch höhere Wellen, als sie ohnehin schon gemacht hätten. Mit ihren Motoren verpesteten sie die Luft, manche hinterließen einen leichten Ölfilm auf dem Wasser. Roberto hasste Boote. Er ging stets zu Fuß durch die engen Gassen, ein Boot hatte er sich nie leisten können, aber er hätte auch keins gewollt. Immer wenn ein Wasserfahrzeug an der Stufe neben der Bogenbrücke vorbeifuhr, bildeten sich viele Wellen. Nahezu unaufhörlich schwappten sie in Robertos Richtung. Manche waren hoch genug, um seine Füße zu erreichen. Sauberer wurden sie dadurch nicht. Oft blieb ein Stück Müll zwischen seinen Zehen hängen, welches er dann zum Ausruf eines Schimpfwortes abschüttelte.
Wie ein Gentleman half Herr Fusco seiner Frau auf ein kleines Ruderboot an einem Pier hinter dem Hotel Venezia. Ihr entging dabei nicht, dass er währenddessen nur Augen für eine zierliche Kellnerin im angrenzenden Straßencafé hatte. Fast hätte er das Gleichgewicht verloren, so sehr ruhten seine Augen auf dem Hüftschwung der Espresso servierenden Schönheit. Sein Gesichtsausdruck war fast traurig, als das Boot ablegte und der Touristenführer es von der Steinkante in die Mitte des Kanals manövrierte.
Laut schnatternd schüttelte sich die Ente und flog mit schnellem Flügelschlag davon.
Diesmal hatte Roberto mit seinem brennenden Streichholz getroffen. Zufrieden wippte er mit seiner Angel, als ein Ruderboot in einiger Entfernung auftauchte. Direkt erlangte das weiße Sommerkleid seine Aufmerksamkeit.
Mit kräftigen Schlägen ruderte der Bootsführer das hölzerne Boot durch Venedig. Nebeneinander zu sitzen, hatte Herr Fusco mit einem „Nee ist mir zu eng so“ abgewimmelt, also saß das Ehepaar getrennt hintereinander. Laut und eindringlich klingelte das Mobiltelefon von Herr Fusco. Hektisch stützte er sich nach hinten, um es aus der Tasche seiner immer perfekt sitzenden Anzughose zu holen. Durch die schnelle Bewegung geriet das Boot aus dem Gleichgewicht, es schwankte und überraschte den Bootsführer mitten in seiner Bewegung. Die frisch Verheiratete verlor die Orientierung und plumpste unter lautem Geschrei in den stinkenden Kanal. Herr Fusco nahm seinen Anruf entgegen. Wild rudernd versuchte sich seine Frau über Wasser zu halten, ihre Frisur war ruiniert und erst ihr Kleid…
Roberto hatte die tragische Szene beobachtet. Er lächelte müde und erklärte den Angeltag für beendet. Seine letzte Zigarette flammte auf, und er schob seine Füße in ein Paar ausgetretene Badeschlappen. Den Fisch legte er in der Tüte zurecht und begann die Angel einzuholen.
Der Bootsführer ergriff die Initiative und streckte seinen Arm aus, um die Frau zu retten. Herr Fusco sah das nur aus dem Augenwinkel, sein Telefonat hatte höhere Priorität. Mit großer Anstrengung zog der Bootsführer die nasse Frau an Bord. Ihre Haare hingen ihr ins Gesicht, einige Plastikreste hatte sich darin verfangen. Ihr Blick senkte sich auf ihre Hand. „Neeein, der Ehering ist weg!“, schrie sie erbost. Sie begann zu weinen. Herr Fusco beendete das Telefonat in diesem Moment und antwortete kühl: „Naja, vielleicht hat es nicht sollen sein.“
Die letzte Zigarette ging zu Ende, Roberto schnippte sie in den vom Sonnenuntergang beleuchteten Kanal. Mit leisem Surren glitt die Schnur durch in die Rolle seiner Angel.
Er griff zur Tüte mit dem Tagesfang und schulterte die Rute. Fast hätte Roberto das goldene Schimmern an seinem Haken übersehen.
ZKS Story – Der Auftakt
 „Es war einmal… „, so klassisch fangen unsere Kurzgeschichten wohl nicht mehr an! Die neue Storyreihe des ZKS lässt sich eher mit: Studentisch, kreativ und definitiv lesenswert beschreiben! In regelmäßigen Abständen liefern wir euch ab sofort die schönsten Kurzgeschichten. Und das Beste: alles ist selbstverfasst von unseren Studierenden!
„Es war einmal… „, so klassisch fangen unsere Kurzgeschichten wohl nicht mehr an! Die neue Storyreihe des ZKS lässt sich eher mit: Studentisch, kreativ und definitiv lesenswert beschreiben! In regelmäßigen Abständen liefern wir euch ab sofort die schönsten Kurzgeschichten. Und das Beste: alles ist selbstverfasst von unseren Studierenden!
„Der gefährlichste Flugabschnitt“, so heißt die erste unserer Kurzgeschichten von Amelie Bender.
Also: Boarding started – wenn ihr bereit seid, geht’s los!
Der gefährlichste Flugabschnitt
„Passagiere für den Flug AB4389 nach München bitte zu Gate 13, das Boarding startet jetzt.“
Aufgeregt stellte ich mich in die Schlange am Gate an und konnte es kaum erwarten der Stewardess mein Flugticket zu zeigen. Als ich schließlich vorne stand, hätte ich es vor Aufregung fast fallen gelassen. Die Stewardess lächelte mich freundlich an, checkte mein Ticket und wünschte mir einen guten Flug. Durch einen relativ langen Finger näherte ich mich dann dem Flugzeug, das mich nach München bringen sollte: mein erster Zwischenstopp. Vor dem Eintreten berührte ich kurz mit den Fingern die weiße Außenwand, sie fühlte sich stabil und kühl an. Drinnen war der Flieger schon gut gefüllt: Deutsche, englische, sogar dänische Wortfetzen drangen an mein Ohr. Neben mir auf den Plätzen 14b und c saß ein junges Pärchen, das verträumt aus dem Fenster starrte. Minuten später rollten wir zur Startbahn. Ich setzte mich gerade hin und versuchte mich auf die Stewardessen zu konzentrieren, die uns Passagiere auf die Sicherheitsvorkehrungen hinwiesen. Doch wir durften noch nicht abheben. Schnell schob ich mir noch ein Kaugummi gegen den Ohrendruck in den Mund und richtete meinen Blick auf die ausgeklappten Bildschirme, welche die Startbahn vor uns zeigten. Unzählige Signale blinkten am Boden. Wer sollte denn da durchblicken? Kurz darauf setzten wir uns in Bewegung, erst langsam, dann immer schneller. Die Sekunden zogen sich in die Länge, der Lärm der Turbinen dröhnte in meinen Ohren und das Fahrbahnende kam beängstigend schnell näher. Heb endlich ab! Der Pilot schien auf meine Ängste gehört zu haben, denn in diesem Moment hob sich die Nase des Fliegers und ich spürte, wie ich in meinen Sitz gedrückt wurde. So schnell, als wollte ich ein Wettessen gewinnen, kaute ich auf meinem Kaugummi herum, schob es von einer Mundseite zur anderen und starrte auf den blauen Himmel auf dem Bildschirm. Ich hasste das Gefühl von einer scheinbar unsichtbaren Macht in den Sitz gedrückt zu werden, ich hasste den Druck auf den Ohren und vor allem hasste ich die Ungewissheit, ob wir den Abflug schaffen würden.
Hatte ich aus dem Augenwinkel gerade einen Vogel am Fenster vorbeifliegen sehen? Plötzlich ruckelte der Flieger samt Inventar, Crew und Passagieren. Ängstlich drückte ich gegen meine Rückenlehne, doch sie hielt stand, sie war nicht abgerissen. Auch der Sitz schien noch fest am Boden montiert und versuchte mir Halt zu geben. Dennoch war der Ruck nicht nur mir durch Mark und Bein gefahren. Wirre Wortfetzen drangen an mein Ohr. Kinder schrien. Irgendwo klingelte leise ein Wecker, den ein Gast wohl im Handgepäck verstaut hatte. Erneut durchfuhr mich ein Ruck. Bildete ich mir das nur ein oder hörte sich die Turbine an meiner Seite irgendwie ungesund? Ein Blick aus dem Fenster konnte mir jedoch nicht helfen, denn draußen herrschte grauer Einheitsbrei. Wo ist das schöne Wetter hin? Schnell wandte ich den Blick ab und rutschte unruhig in meinem Sitz hin und her. Auch wenn ich draußen nichts hatte erkennen können, das Gefühl in meinem Bauch trieb mir den Schweiß auf die Stirn. Mit feuchten Händen umklammerte ich die Lehne und starrte auf den Bildschirm. Sind wir noch schnell genug? Allerdings zeigte der Bildschirm weder unsere Geschwindigkeit noch unsere Höhe an. Mein Atem rasselte als würde ich persönlich hinter dem Flugzeug herlaufen und es anschieben. Mein Gefühl sagte mir, dass wir immer langsamer wurden. War es dafür nicht noch viel zu früh? Wir konnten unsere Flughöhe noch nicht erreicht haben. Wieder ruckelte es. Ich wurde heftig im Sitz hin und her gerissen, stieß mit dem Kopf gegen die Kabinenwand und sah erstmal gar nichts mehr. Tränen schossen mir in die Augen, während ich nach der Wunde tastete. Um mich herum schrien die Menschen. „Wir stürzen ab!“ Noch bevor mein Kopf die Worte verarbeiten konnte, reagierte mein Bauch. Mein Frühstück widersetzte sich der Natur und bewegte sich wie eine Lawine meine Speiseröhre bergauf, denn wir verloren an Höhe. Schnell. Zu schnell. Ich presste meine Lippen aufeinander. Durch den Tränenschleier blitzte es rot auf. Irgendwas Hartes streifte meine Schulter. Ich klammerte mich mit aller Kraft an den Sitz. Der Sicherheitsgurt bohrte sich in meinen Bauch. Der Lärm schwoll an. Bis alles in einem ohrenbetäubenden Erdbeben unterging und schwarz wurde.
Der Wecker klingelte. Sofort saß ich aufrecht im Bett und schnappte nach Luft. Nachdem ich ein paar Mal tief eingeatmet und wieder ausgeatmet hatte, galoppierte mein Herz immer noch in meiner Brust. Der Flieger war nicht abgestürzt, er war noch nicht einmal gestartet. Ich befand mich noch immer in meinem Bett in Hamburg. Ich gönnte mir ein paar weitere Sekunden Erholung, bevor ich aufstand, um pünktlich am Flughafen zu sein. So stand ich eine Viertelstunde später in der Küche und frühstückte eine Schale Müsli. Eigentlich hatte ich gar keinen Hunger vor lauter Aufregung, aber ohne Frühstück ging ich nie aus dem Haus. Da die Autobahn zu dieser frühen Stunde noch kaum befahren war, kam ich schneller als gedacht ans Ziel. In der noch leeren Abflughalle suchte ich mir einen Platz in der Nähe der Fenster und betrachtete die Flugzeuge vor der Scheibe, die im elektrischen Licht wie große weiße Kraniche strahlten. Welches wohl mein Flieger sein würde? Wie durch einen Nebelschleier nahm ich wahr, dass sich die Plätze um mich herum langsam füllten. Allmählich begann es vor dem Fenster zu dämmern, ungeduldig wippte ich mit den Beinen. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich auf die Uhr geschaut hatte, als endlich mein Flieger aufgerufen wurde: „Passagiere für den Flug AB4389 nach München bitte zu Gate 13, das Boarding startet jetzt.“
Die Schlange am Gate war schon erstaunlich lang, als ich ihr Ende erreichte. Es gab immer genug Leute, die in der Gate-Nähe nur darauf warteten, dass das Boarding begann und sie wie eine Horde wilder Pferde losstürmen konnten. Als ich den Kopf der Schlange bildete, zeigte ich mit zittriger Hand dem Bodenpersonal mein Ticket. Die junge Frau lächelte mich an, checkte das Ticket und wünschte mir einen guten Flug. Ein langer Finger führte mich und die anderen Passagiere zum Flieger. Dieser stand sicher auf dem Boden und wies keine großen Makel auf, wie ich feststellte, als ich seine Außenwand kurz berührte. Dennoch war ich unsicher, als ich durch die Tür eintrat. Ich atmete tief durch und ging zu meinem Sitz 14a. Ich schluckte, setzte mich hin und schnallte mich sofort an. Es war nur ein Traum. Mit feuchten Händen verfolgte ich wie die Stewardessen die Sicherheitsvorkehrungen durchgingen, nachdem die Türen geschlossen worden waren, und starrte anschließend auf den ausgeklappten Bordbildschirm vor mir. Das Kaugummi, das ich mir in den Mund schob, hatte keine Chance gegen meine Zähne, die zur Hochleistungsbearbeitung des Kaugummis ansetzen. Nebenbei versuchte ich gleichmäßig zu atmen und krallte die Finger doch in die Armlehnen. Wir rollten los, aber nur bis zum Ende der Startbahn, dort hielten wir erneut an. Wieder keine direkte Abflugerlaubnis. Ich wünschte, wir wären schon da.
Dann setzte sich der große, weiße Vogel in Bewegung. Um mich abzulenken, stellte ich mir gerne vor, wie wir zuerst ein Känguru, dann einen Leoparden und zuletzt einen Geparden überholten, bevor das Flugzeug schließlich abhob. Parallel zu meinem Gedankenspiel hob sich die Nase des Flugzeugs und wir hoben tatsächlich ab. Die gefährliche, unsichtbare Macht presste mich in die Polster. Ich schob das Kaugummi von einer Backe in die andere – Außenstehende hätten meinen können, ein Flummi würde in meinen Backen hin und her springen. Gleichzeitig dachte ich im Gleichtakt mit meinem Atem: einatmen, ausatmen. Es ruckelte. Bitte nicht schon wieder. Es ruckelte noch einmal. Ich kniff die Augen zu und wartete auf Schreie, doch das Flugzeug beruhigte sich wieder etwas. Weitere Minuten wurden wir leicht durchgeschüttelt, bevor der Himmel das Flugzeug aufnahm und wir uns ungestört vorwärts bewegen konnten. Ich hingegen entspannte mich wesentlich langsamer. Erst nachdem die
Anschnallsignale ausgeschaltet wurden und der Pilot uns begrüßt hatte, beendete mein Herz seinen Sprint. Wir hatten einen der gefährlichsten Flugabschnitte überstanden: den Start. Das Mädchen neben mir lächelte mich mitfühlend an.
„Keine Angst, der Flug ist nicht lang. Wir sind schneller wieder unten, als du denkst.“
Das waren nicht gerade die Worte, die mich aufmunterten.
„Ich glaube, die Stewardess wird unsere Reihe besonders betreuen müssen.“
Sie wies auf die zwei jungen Frauen auf der anderen Seite des Gangs. Die Gesichtsfarbe der Rothaarigen war käsig, dennoch starrte sie mit funkelnden Augen auf den Bildschirm vor ihr. Ihre Sitznachbarin hingegen hatte keinen Blick übrig für das Geschehen außerhalb des Fliegers, da ihr Kopf in einem Spuckbeutel steckte. Sie machte jedoch keine Geräusche. Ich lächelte meine Nachbarin an und erzählte ihr mit leiser Stimme von meinem Traum der letzten Nacht. Sie beruhigte mich, dass es nur ein Traum gewesen sei und wir sicherlich gut in München landen würden. Ich nickte. Dann wandte sie sich ihrem Freund zu, der auf ihrer anderen Seite saß, und gemeinsam betrachteten sie breit lächelnd die Wolkenformationen vor dem Fenster. Mit den großen Wolkenbergen wollte ich mich jetzt lieber nicht befassen. Mit Wolken verband ich Turbulenzen und an die wollte ich gerade definitiv nicht denken.
Also nahm ich mir meinen Australien Reiseführer aus der Sitztasche und blätterte ziellos hin und her. Ich wusste, dass ich mich nicht mit meiner Angst beschäftigen sollte. Es würde nur schlimmer werden. Dahingegen stellte der Reiseführer etwas Schönes dar, denn er sollte mir helfen das nächste Jahr in Australien glücklich zu leben. Mein Blick blieb an einem Bild, der gefährlichsten Spinne der Welt hängen, die in Australien lebte. Ich wusste über die Gefahren Bescheid, die dieses Land barg: angefangen bei den giftigen Zähnen der Spinnen und Schlangen bis zu den kräftigen Fäusten der roten Riesenkängurus. Dennoch fürchtete ich mich weniger vor der Natur als vor dem Ungewissen. Wie wird mein Leben dort aussehen? Ich allein am anderen Ende der Welt ohne einen Plan für das nächste Jahr? Das war nicht meine Art, aber ich wollte etwas Neues wagen und außerdem wollte ich schon so lange mal nach Australien, in mein Traumlandparadies.
Die Stewardess riss mich aus meinen Träumen, als sie neben mir mit Papiertüten raschelte. Erleichtert vernahm ich aber weiterhin keinen unangenehmen Geruch. Das Mädchen auf der anderen Seite des Gangs hatte die Papiertüte im Schoß liegen und hielt ein Glas Wasser mit beiden Händen fest umklammert. Nachdem die Stewardess weitergegangen war, bot ich ihr meinen Reiseführer zum Ablenken an – ich hatte schließlich noch genug Zeit ihn während meiner Flüge zu lesen. Lächelnd nahm sie ihn entgegen. Wir redeten kurz über unsere Reiseziele, bevor sie sich dem Buch zuwendete.
Ich schloss die Augen und dachte an mein Ziel. Ein leichter Wind wehte. Ich roch das Salz des Meeres, spürte den warmen Sand unter meinen Füßen und fühlte die wohlig warme Sonne auf meiner Haut. Dann nahm der Wind zu, zerrte an meiner Kleidung und schleuderte mir meine vom Salz verkrusteten Haare ins Gesicht. Ich roch Feuer. Schnell riss ich die Augen auf, bevor mein Tagtraum komplett außer Kontrolle geriet.
Vorsichtig schnupperte ich. Kein Feuer, aber es roch nach verbranntem Toast und der Wind war auch nicht erträumt, es ruckelte schon wieder. Ich atmete tief ein und wagte einen Blick aus dem Fenster.
Das hätte ich besser bleiben gelassen. Es hatte sich nicht nur zugezogen, es war pechschwarz draußen. Wir flogen mitten durch ein Gewitter. Die Anschnallsignale blinkten schlagartig auf, was für mich keine Handlung bedeutete – ich war noch angeschnallt. Wieder krallte ich meine Finger in die Sitzlehnen, die meine Sitznachbarin glücklicherweise nicht benötigte, da ihr Freund ihre Hände in den seinen hielt. Wir wurden durchgeschüttelt. Es nahm überhaupt kein Ende. Jeder Blick aus dem Fenster hielt mir vor Augen, dass noch keine Besserung in Sicht war. Dann musste sich selbst noch die Crew hinsetzen. Am liebsten hätte ich aufgeschrien. Warum war ich ausgerechnet heute bei diesem Wetter in das Flugzeug gestiegen? Vielleicht hätte ich meinen Traum als Omen sehen sollen? Nein, ich war nicht abergläubisch. Eigentlich passierte bei Turbulenzen in der Luft auch nur äußerst selten was. Start und Landung waren viel gefährlicher. Einatmen, ausatmen. Neben mir knisterte es. Ich entdeckte braune Haare, die aus einer Papiertüte zu wachsen schienen. Die Rothaarige neben ihr hatte ihr eine Hand auf den Rücken gelegt, sah aber aus wie ein Zombie, genauso wie ich mich fühlte. Mein Reiseführer befand sich in Sicherheit in ihrer Sitztasche, wo ich ihn allerdings nicht erreichen konnte, um mich abzulenken.
Mein Traum würde sich erfüllen, in etwas mehr als einem Tag würde ich erstmals australischen Boden betreten. Ich freute mich auf die Erfahrungen, die Landschaft, die netten Australier – zumindest hatte ich schon von vielen gehört, wie hilfsbereit die Menschen dort waren. Plötzlich verloren wir ein paar Meter, fielen wie in ein Loch und mein Frühstück drohte mir aus meinem Magen. Ich schluckte, während ein paar Kinder weinten und ihre Mütter versuchten sie zu trösten. Meine Fingernägel bohrten sich wie Krallen in den Stoff der Lehnen und stießen auf das Plastik darunter. Ich wusste, dass so ein Flugzeug stabil in der Luft lag; würde es hingegen zum Aufprall kommen, würde es wie ein Spielzeug zerbrechen. Keine schöne Vorstellung.
„Bitte bleiben Sie angeschnallt an Ihren Plätzen. Wir setzen nun zur Landung an und es kann turbulent werden.“, ertönte die Stimme des Co-Piloten aus den Lautsprechern.
Dürfen die bei den Bedingungen überhaupt landen? Ist das nicht zu gefährlich? Ich hoffte inständig, dass der Pilot wusste, was er tat. Andererseits durfte nur ein Pilot mit viel Erfahrung einen derartigen Flug übernehmen, ich musste ihm vertrauen.
Hatte ich gerade das Gefühl, wir wären durchgeschüttelt worden, so lernte ich nun, was das wirklich hieß. Ich knallte gegen alle möglichen Ecken, während ich die Grenzen des Sicherheitsgurtes ungewollt austestete, der den wilden Kräften zwar standhielt, mich ihnen aber auch aussetzte. Als ich mit dem Kopf gegen die Kabinenwand knallte, dröhnte nicht nur mein Kopf, sondern auch mein Herz. Es schlug so laut wie nie zuvor. Es verdeutlichte mir den Lärm im Flieger, während ich durch einen Tränenschleier kaum etwas sehen konnte. Zum Erholen blieb mir jedoch keine Zeit, da ich bereits wieder nach hinten gerissen wurde. Ungeschickt tastete ich nach meiner Schläfe. Der Aufprallort pochte, als säße mein Herz direkt hinter meiner Schläfe, doch Blut fühlte ich keins. Meine Sitznachbarn hatten sich vornübergebeugt und an ihre Vordersitze gelehnt. Ich kannte die Pose von Bildern. Sie versuchten sich vor dem Absturz in eine sichere Position zu bringen. Nein, nein, nein. Um mich herum schrien die Leute. Angst hört sich in jeder Sprache gleich an, ob englisch, deutsch oder dänisch. Eine Handtasche streifte meine Schulter und verfehlte meinen Kopf um Zentimeter. Ich zuckte zusammen.
Ein Blitz riss meine Aufmerksamkeit zum Fenster. Draußen war es für einen Augenblick heller als drinnen. Doch der Anblick all der Wolken und der zitternden Flügel ließ mich schlucken. Wie will der Pilot bei den Bedingungen die Landebahn treffen? Ich zog meinen Sicherheitsgurt enger, auch wenn er sich dann in meinen Bauch bohrte, so verlor ich wenigstens nicht so schnell das Bewusstsein. An Australien denken half nicht mehr, es klappte auch nicht mehr, die Realität beanspruchte mich und meine Gedankenwelt. Im Sekundentakt traf uns eine neue Windwelle und riss das Flugzeug wie ein Schiff auf hoher See gefährlich hin und her. Krampfhaft spannte ich meine Muskeln an und versuchte den Kollisionen mit Flugzeuginventar oder Handgepäck aus dem Weg zu gehen. Doch es klappte nicht allzu gut, da mir mein Körper nicht voll gehorchte. Ich zitterte. Als ein nasser Fleck auf meinem Bein entstand, realisierte ich, dass mir Tränen aus den Augen liefen. Mit meinem Ärmel wischte ich sie weg.
Wenn ich gesund landen sollte, wusste ich nicht, ob ich jemals wieder in ein Flugzeug steigen würde, auch nicht nach Australien. Neben mir erklangen Würgegeräusche. Auch mein Mageninhalt pochte nun kräftiger gegen meine Speiseröhre. Ich versuchte ihn runter zu schlucken, doch wir verloren an Höhe, was mein Vorhaben nicht begünstigte. Ich versuchte mir einzureden, dass es normal sei bei der Landung Höhe zu verlieren, aber mein Herz ließ sich nicht beruhigen. Es schlug unglaublich schnell. Zu schnell für meinen Geschmack. Ich presste meine Lippen aufeinander. Irgendwas Hartes streifte meinen Kopf. Ich klammerte mich mit aller Kraft an den Sitz. Der Sicherheitsgurt bohrte sich in meinen Bauch. Der Lärm schwoll an. Bis alles in einem ohrenbetäubenden Erdbeben unterging und schwarz wurde.
Hell und dunkel. Irgendwo musste Licht sein. Rauschen drang an mein Ohr. Ich spürte das weiche Bett unter meinen Fingern. Traum oder Realität? Wortfetzen erreichten mein Gehirn, ergaben aber keinen Sinn. Ich öffnete die Augen. Weiß strahlte die Decke im Tageslicht und blendete mich. Warum steckt ein Schlauch in meiner Hand? Dann kam der Schmerz und ich presste die Augen wieder zu. Meine Fragen waren beantwortet. Vorerst.
Yes, we can relatif!
Zwei unser Texte aus dem letzten Semester haben es in die neue Ausgabe der relatif geschafft. Wir möchten Melina Pospiech zu ihrer Reportage „Der Jetzt-Zustand ist nur das Produkt all dessen, was vorher passiert ist“ über Archäologie in Aachen und Lisa Fromm zu ihrem Portrait „Auf der Suche nach den eigenen Wurzeln: Zwischen Aachen, Israel und Palästina“ über den Nachwusregisseur Wisam Zureik noch einmal herzlich gratulieren. Die Texte könnt ihr auch als relatif-Online-Ausgabe lesen.